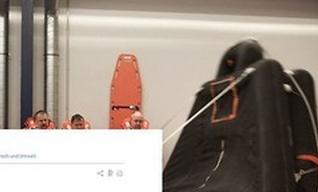Selbstversuch: Absturz im Helikopter
Er
hat es ganz bestimmt nicht ernst gemeint. Es sollte ein Scherz sein.
Trotzdem hat er mit seiner flapsigen Bemerkung mein Kopfkino gestartet.
Seither läuft dort nur noch ein Genre: Katastrophenfilm, ohne Happy End.
Es
war beim Mittagessen in der kleinen Kantine des
Offshore-Trainingszentrums von Falck Safety Services in Bremerhaven. Wir
saßen uns zufällig gegenüber. Er war Teilnehmer eines
Erste-Hilfe-Kurses, ich hatte gerade den theoretischen Part meines
Helikoptertrainings hinter mir. Ich erzählte ihm, dass es nach dem Essen
mit der Praxis weitergehen würde.
„Glaub mir“, unterbrach er
mich, und beugte sich weit über seinen Nudelteller vor, „du wirst heute
Nachmittag nur eine einzige Sache lernen: dass du im Ernstfall der Erste
bist, der ersäuft. So war es zumindest bei mir. Wir mussten zweimal
abbrechen, weil ich so viel Wasser geschluckt hatte.“
Dann
erzählte er mir kauend von seinen Erste-Hilfe-Übungen, aber ich konnte
nicht mehr richtig folgen. In meinem Kopf hatte der Vorspann eines
Katastrophenfilms begonnen.
Inzwischen bin ich über die harmlosen
Anfangssequenzen längst hinaus. Ich habe die übrigen Protagonisten
kennengelernt – die Trainergruppe, die Taucher, die mich im Notfall aus
dem Wasser bergen sollen, und die anderen elf Teilnehmer. Ich habe mich
in mein Kostüm gezwängt – den orangenen Trockenanzug, den Helm und den
kleinen Brustsack, den ich mithilfe eines kurzen Schnorchels aufblasen
kann, um im Notfall daraus zu atmen. Und ich habe den Schauplatz der
Katastrophe betreten – das Schwimmbecken von Falck.
Über dem
Wasser schwebt an einer Art Seilwinde eine Helikopter-Attrappe. Sie
besteht nur aus dem Rumpf, keine Rotorblätter, keine Kufen. Hinten ist
sie offen, im Inneren sehe ich vier Sitzplätze, zwei im Cockpit, zwei
dahinter. Die Fenster bestehen aus Plastikscheiben, der Boden aus einem
Metallgitter. Das ist das Gefährt, das mich gleich unter die
Wasseroberfläche ziehen wird.
Ich muss an Szenen aus Titanic denken
Ein
Ausbilder ruft die Namen von vier Teilnehmern auf, die als erste dran
sind, auch meiner ist darunter. Ich bin erleichtert, dass es sofort
losgeht. Besser man trägt sein Kreuz, als dass man es hinter sich
herschleift.
Wir springen ins Becken und ein Ausbilder am Rand
lässt über eine Fernsteuerung den Hubschrauber zu uns hinunter, bis er
zu etwa einem Drittel eingetaucht ist. Sekundenschnell steigt das Wasser
im Inneren. Szenen aus „Titanic“ erscheinen vor meinem geistigen Auge,
nach der Sache mit dem Eisberg.
Ich schwimme in die Kabine und
nehme hinten links Platz, neben einem viereckigen Fenster von der Größe
eines Frühstückstabletts. Ich weiß, dass ich dort gleich hindurchtauchen
soll, auch wenn ich mir in meinem unförmigen Overall mit Helm und
Rettungsweste kaum vorstellen kann, wie das funktionieren soll.
Andererseits: Rechts neben mir sitzt ein echter Schrank von einem Kerl –
und bei ihm gehen die Ausbilder ja offenbar auch davon aus, dass er
hindurch passt.
Jeder von uns vier Teilnehmern bekommt einen
persönlichen Trainer zugeteilt, der während der Übungen in der Kabine
bei uns sein wird. Ich bemerke, dass meiner schon seit einer Weile mit
ruhiger, verständnisvoller Stimme auf mich einspricht. Wie war sein
Name? Jörg?
Ich mag ihn nicht noch einmal danach fragen und nehme
mir vor, mich ab sofort zusammenzureißen. Houdini hat sich aus viel
gefährlicheren Situationen befreit, da werde ich doch wohl mit diesem
Spielzeugheli fertig werden.
Mein Trainer, ich nenne ihn Jörg,
erklärt mir noch einmal die wesentlichen Punkte: „Präg dir die
Referenzpunkte in der Kabine ein, damit du die Orientierung behältst,
wenn es losgeht. Wo ist das Fenster? Wie sind die Sitze angeordnet?“
Die
wichtigste Regel schärft Jörg mir gleich mehrmals ein: „Schalte deinen
Kopf ein! Lass ihn die Steuerung übernehmen! Keine Panik!“
Ich
werde ruhiger. Tausende haben das hier vor mir geschafft, Tausende
werden es nach mir schaffen. Auch der angekündigte Ablauf der Übung
kommt mir entgegen: Wir werden mehrere Helikopterfahrten machen, wobei
der Schwierigkeitsgrad nur langsam steigen soll. Genug Zeit, mich daran
zu gewöhnen.
Rasend schnell steigt das Wasser in der Kabine
Es
beginnt ganz simpel. Der Helikopter fährt aus einer Höhe von kaum zwei
Metern bis auf die Wasseroberfläche hinunter, anschließend müssen wir
zügig durch die Tür vorn aussteigen. Kinderspiel.
Doch schon die
zweite Fahrt ist von einem anderen Kaliber. Nach dem internationalen
Alarmruf „Brace! Brace! Brace!“ taucht der Helikopter diesmal komplett
ins Becken, in rasendem Tempo steigt mir das Wasser über Beine, Bauch
und Brust.
Gerade rechtzeitig noch hole ich tief Luft, da sitze
ich auch schon komplett unter der Oberfläche, festgeschnallt in meinem
Sitz. Ich schließe die Augen, durch das brodelnde Gemisch von Luftblasen
würde ich ohnehin wenig sehen. Außerdem trage ich Kontaktlinsen, wie
mir jetzt einfällt. Warum erst jetzt?!
Ich zähle unter Wasser bis
drei, bis die imaginären Rotorblätter über mir ihren Betrieb
eingestellt haben. Wenn ich zu früh aussteige, könnten sie mich köpfen.
Dann drücke ich mit dem linken Arm kräftig die Plastikscheibe aus dem
Fenster. Anschließend löse ich den Gurt vor meinem Bauch.
Sofort
reißt mich der starke Auftrieb des Trockenanzugs nach oben, weg von dem
Fenster, durch das ich aussteigen will. Referenzpunkte merken!, schießt
es mir durch den Kopf. Mit der linken Hand umgreife ich die Einfassung,
in der eben noch die Fensterscheibe gesteckt hat.
Ich ziehe mich
durch die enge Öffnung nach draußen, wobei ich halb bewusst einen
Widerstand an meinen Füßen spüre. Mein Kopf bricht durch die
Wasseroberfläche und ich sauge Luft in meine Lungen. Kaum zehn Sekunden
nach dem Untergang der Kabine.
„Du willst wohl unbedingt
überleben, was?“, grinst mich Jörg an, als auch er aus der Kabine
getaucht ist. Der Widerstand an meinen Füßen – das war seine Schulter.
Beim Versuch, mich zu befreien, muss ich heftig gestrampelt und ihn an
der Schulter erwischt haben. Dabei hatten uns die Ausbilder
eingeschärft, vorsichtig zu sein, um andere Insassen nicht zu verletzen.
„Immer mit der Ruhe“, sagt Jörg ohne Groll. „Schalte deinen Kopf ein.“
Die
nächste Übung gleicht der vorigen, nur dass wir diesmal den Schnorchel
einsetzen sollen, der vor unserer Brust an einem kleinen Luftsack
befestigt ist. Bevor wir im Wasser versinken, müssen wir kräftig Luft
holen. Damit haben wir einen Vorrat von vielleicht zehn, fünfzehn
Atemzügen, schließlich verbraucht der Körper immer nur einen Teil des
eingesaugten Sauerstoffs. Im Ernstfall kann das Leben retten.
Ich
meistere auch diesen Durchgang, obwohl der dicke Gummischnorchel in
meinem Mund einen leichten Würgereiz erzeugt und ich den Luftvorrat gar
nicht nutze. In der Hektik habe ich nicht daran gedacht und schlicht die
Luft angehalten.
Von Fahrt zu Fahrt werde ich routinierter, Jörg
bekommt keine Tritte mehr ab. Oder ist er einfach zu höflich, mir davon
zu erzählen? Ich weiß es nicht, die Ausstiege erfordern so viel
Konzentration, dass ich unmöglich auch noch auf meine Füße achten kann.
Jetzt
sitze ich wieder in meinem Sitz, Jörg schließt den Gurt und zieht die
vier Riemen stramm, die über meine Schultern und die Oberschenkel
verlaufen. Ich muss wieder an Houdini denken, den Entfesselungskünstler.
Moment mal, fällt mir plötzlich ein, ist Houdini nicht am Ende bei so
einem Trick draufgegangen?
Ich kämpfe mit einem Anflug von Panik, zumal Jörg nun den Höhepunkt der Übungen ankündigt: Der Hubschrauber wird komplett im Wasser versinken und sich dabei auf den Kopf drehen. „Bist du bereit?“, fragt Jörg. Ich nicke stumm.
Dann bleibe ich in der Fensteröffnung hängen
Die
Seilwinde zieht die Kabine nach oben. „Steuerbord?“, fragt der
Ausbilder mit der Fernbedienung am Beckenrand. Offenbar geht es um die
Richtung, in die der Helikopter kippen soll. „Okay“, sagt einer von
Jörgs Kollegen in der Kabine. Ich grabe in meinem Gedächtnis: Heißt das
rechts oder links herum? Und von wo gesehen überhaupt?
„Brace!
Brace! Brace!“ - Der Hubschrauber rauscht ins Wasser hinunter und
beginnt sich zu drehen, kaum dass das erste Wasser durch das
Metallgitter im Boden schießt. Nach rechts, übrigens. Da ich links
sitze, habe ich etwas länger Luft als der Schrank im Sitz rechts von
mir. Ich bin ein Glückspilz.
Unter Wasser kämpfe ich kurz um die
Orientierung. Wo ist das Fenster? Ich hänge ja jetzt kopfüber im Sitz.
Links! Wenn es vorhin da war, muss es auch jetzt noch da sein, der halbe
Salto kann daran nichts geändert haben. Ich zähle bis drei
(Rotorblätter!), drücke die Scheibe des Fensters hinaus, das sich jetzt
unter mir befindet, und ziehe mich durch die Tiefe in die Öffnung.
Aber
irgendwie bleibe ich mit Schnorchel und Luftsack am Fensterrahmen
hängen. Und plötzlich ist es um meine Konzentration geschehen. Statt
mich vorsichtig von der Kante wegzudrücken, dränge ich mit aller Kraft
nach vorn. Schließlich löse ich mich vom Fenster. Mit einem kräftigen
Tritt gegen die Außenwand der Kabine befördere ich mich nach oben.
Geschafft! Kurz darauf ist Jörg neben mir. Er hebt den Daumen und
grinst. Meinen Panikmoment hat er offenbar nicht mitbekommen. Auch ich
muss grinsen.
Ich ziehe mich in meinem triefenden Trockenanzug
aus dem Becken. Draußen warten schon die nächsten Teilnehmer. „Und?“,
fragt mich einer. Mir liegt der Satz des Kollegen vom Mittagessen auf
der Zunge. „Das Einzige, was du heute lernen wirst …“ Aber das wäre
nicht fair. „Leichter, als es aussieht“’ sage ich. „Du packst das
schon!“
Dann wanke ich zur Dusche, um mir den Anzug auszuziehen. Ich muss dringend mal nach Houdini googeln, denke ich dabei.
http://www.energie-winde.de/mensch-und-umwelt/details/unfall-auf-knopfdruck-teil-2.html