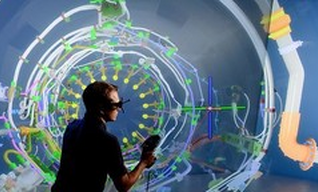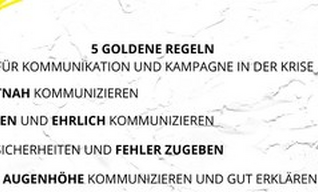VIRTUELLE HOSPITÄLER UND REALE CHANCEN - Text für die Süddeutsche Zeitung
Deutschlands Krankenhäuser
stehen vor der digitalen Transformation.
Sie schafft neue
Behandlungsmöglichkeiten und kann dazu beitragen, das System zu
entlasten, wenn die richtigen Weichen gestellt werden.
Foto hier: Depositphotos
Eine schwer verletzte Frau liegt bewusstlos am Boden. Medizinische
Ersthelfer erkennen, dass sie schnell mit Medikamenten versorgt werden
muss. Mit einem Klick auf ihre Krankenakte in der Cloud sind ihre
medizinischen Daten verfügbar. Sie wissen innerhalb von Sekunden, an
welchen Allergien die Frau leidet, welche Blutgruppe sie hat, ob sie
geimpft ist und welche Medikamente sie im Alltag braucht. Ein Präparat,
das bei ähnlichen Verletzungen oft verabreicht wird, verträgt sie nicht.
Sie bekommt daher noch am Unfallort ein Alternativmittel. Die Helfer
sehen auch, dass die Frau Tabletten bekommt, um eine Krebserkrankung
abzuwenden, die sie noch gar nicht hat, deren bevorstehender Ausbruch
aber vorab von künstlicher Intelligenz erkannt wurde. Nach wenigen Tagen
in einer auf ihre Verletzungen spezialisierten Klinik, in der sie
intensiv versorgt wurde, kann sie nach Hause entlassen werden. Ihre
Brüche heilen dort genauso gut. Sie wird via Telefon und App, also
mithilfe von Telehealth, von Ärzten betreut und zusätzlich vor Ort von
Pflegekräften versorgt. Die letzte, einfachere OP, ein Routineeingriff,
kann beim Tageschirurgen durchgeführt werden.
Die Geschichte zeigt:
Krankenhausaufenthalte im Jahr 2030 werden sicherlich kürzer und nur bei
besonders schweren Verletzungen erforderlich sein. Es wird weniger
Krankenhäuser geben. Vieles andere wird ausgelagert sein. Zugleich
werden wir Krankheit mittels Daten anders begegnen. Frank Stratmann,
Director Hospital & Health bei der Kreativagentur Edenspiekermann,
betont: Der Nutzen der über die Jahre zusammengetragenen
Gesundheitsdaten ergibt sich nicht allein durch deren Existenz, sondern
vor allem durch deren Verfügbarkeit an Ort und Stelle, egal, ob bei
einem Notfall zu Hause oder unterwegs oder im OP. Der Patient selbst
habe so künftig immer mehr Infos zu seinem Gesundheitszustand. Das
verändere die Beziehungen zwischen Patienten und Ärzten. PFLEGE IST EIN
ZUTIEFST MENSCHLICHER VORGANG, UNTER MAUERT MIT ZUWENDUNG UND
EMPATHIE Das Beispiel macht auch deutlich, dass sich künftig viel mehr
zu Hause abspielen wird. Der Trend geht zum Smart so Prof. Dr. Jochen
Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am Uniklinikum
Essen. Das Krankenhaus werde sich in die eigene Wohnung hinein
weiterentwickeln. Dieses Konzept setzt eine angemessene häusliche
Versorgung voraus, medizinisch und pflegerisch, die Umsetzung von
Telemedizin und auch die Implementierung des Konzepts Virtuelles
Krankenhaus, wie es in Nordrhein-Westfalen vom Landesgesundheitsminister
Laumann angestoßen wurde, erklärt Werner. Das Berufsbild des Arztes
werde sich in den nächsten Jahren auch durch
Entscheidungsunterstützungssysteme wie beispielsweise Ada Health
nachhaltig ändern. In diese App lassen sich bereits heute
Krankengeschichte und Symptome eingeben. Algorithmen schlagen
diagnostische Maßnahmen vor. Hinzu kämen Telemedizinlösungen, die man
sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Dabei gehe es nicht darum,
ergänzt Frank Stratmann, dass der Arzt mehr zum Techniker werde.
Vielmehr müsse er mehr zum Begleiter, Lotsen und Moderator werden und
digitale Kompetenz haben, um Zusammenhänge zu verstehen. Laumann plant
kein Krankenhaus im heutigen Sinne, sondern eine vom Krankenhaus her
gedachte ambulante Versorgung. Der ärztliche Erstkontakt soll
virtualisiert werden. Eine medizinische Einrichtung, zum Beispiel ein
Krankenhaus, wird immer dann einbezogen, wenn das nötig ist. Im
Krankenhaus selbst könnten digitale Innovationen in Zukunft die
Behandlungsqualität weiter steigern und mehr Flexibilität ermöglichen.
Ein wichtiger Hoffnungsträger ist dabei die Robotik in der Chirurgie: So
können roboterassistierte Operationen oft mit präziseren Schnitten
durchgeführt werden. Deshalb ziehen sie Studien zufolge weniger
Komplikationen nach sich. Komplexes medizinisches Spezialwissen wiederum
muss nicht mehr zu jedem Gebiet gleichermaßen im Krankenhaus vertreten
sein, wenn man mithilfe von Telemedizin auf die Expertise eines anderen
Hauses zurückgreifen kann. Auch mit Blick auf Pflegeberufe erwarten
Experten positive Effekte durch die Digitalisierung, allerdings mit
Einschränkungen. Medizinischer und technischer Fortschritt sowie die
Digitalisierung könnten zwar den Pflegebedarf etwas schmälern, dennoch
dürfte die Thematik in den Krankenhäusern weiter an Brisanz gewinnen,
heißt es auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums. Schon jetzt
fehlen viele Pflegekräfte, bekräftigt auch Esther Dürr,
Personalleiterin des St. Vinzenz-Krankenhauses Hanau, derzufolge
Fachkräfte aus dem Ausland eine wichtige Verstärkung sind, die es weiter
zu fördern gelte. Es ist gut, dass im Zuge des neuen
Pflegepersonalstärkungsgesetzes alle Pflegekräfte auf bettenführenden
Stationen von den Krankenkassen finanziert werden. Noch nicht sicher
finanziert werden Anerkennungsmaßnahmen für ausländische Pflegekräfte,
die je nach Herkunftsland notwendig sind, damit ihre Ausbildung bei uns
akzeptiert wird. Diese künftigen Pflegekräfte müssten zunächst
Praxiseinsätze absolvieren, ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen
und Prüfungen ablegen. Bis diese Mitarbeiter die deutsche Berufsurkunde
in Händen halten, könnten bis zu 18 Monate vergehen, in diesem Zeitraum
würden sie als pflegerische Hilfskräfte vergütet. Auch diese Maßnahmen
inklusive aller damit verbundenen Kosten müssen zuverlässig vergütet
werden, betont Esther Dürr. Auch Prof. Dr. Jochen Werner sieht
Möglichkeiten zur Optimierung. Um den Pflegerberuf attraktiver zu
machen, fordert er unter anderem flexiblere Arbeitszeiten, bessere
Zugänge zu Kindertagesstätten, das Vermeiden schweren Hebens sowie der
patientenfernen Beschäftigung mit administrativen Tätigkeiten. Wenn wir
uns dem nicht annehmen, besteht ein relevantes Risiko, dass wir den
Pflegenotstand perpetuieren trotz zusätzlicher Kräfte aus dem Ausland.
Pflegeroboter können seiner Ansicht nach hilfreich sein, etwa wenn sie
das Pflegepersonal bei schweren Hebetätigkeiten entlasten. Als
vollwertigen Ersatz für Menschen sieht er Maschinen im Krankenhaus aber
keinesfalls: Pflege ist ein zutiefst menschlicher Vorgang, untermauert
mit Zuwendung und Empathie, betont der Mediziner.
Eva Werner
Quelle:
docplayer.org