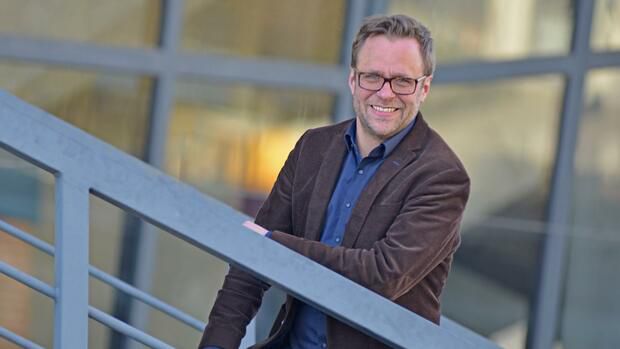Düsseldorf, München Christian Rommert zählt zu jenen Theologen, die ihre Gläubigen auch auch jenseits von Predigt und Gemeindebrief erreichen wollen. Seit 2015 gehört er zum Team der TV-Pastoren, die in der ARD „Das Wort zum Sonntag" sprechen.
Die eigene Kirchengemeinde hat der 47-jährige Bochumer schon vor fünf Jahren aufgegeben, um sich selbstständig zu machen. Er hilft Unternehmern dabei, ihre Firma mit christlichen Werten zu führen. Zumindest war das vor Corona so.
Wie vielen Freiberuflern sind auch ihm im Frühjahr die Aufträge weggebrochen. Seine Ausfälle beliefen sich „mit einem Schlag auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag", sagt Rommert. Der Unternehmer reagierte, indem er kurzerhand sein Geschäftsmodell umstellte.
Seither berät er Veranstalter, wie sie ihre Seminare, Tagungen und Konferenzen als digitale Events ins Internet transferieren können. Kleine Veranstaltungen ab 50 Teilnehmer, aber auch riesige mit Tausenden Menschen. „Auf Staatshilfe zu warten wäre für mich der falsche Weg gewesen", so Rommert.
Die Bundesregierung sagt für dieses Jahr die schwerste Rezession der Nachkriegszeit voraus. Menschen wie Rommert lassen sich davon jedoch nicht entmutigen. Und der Theologe ist bei Weitem nicht der einzige Berufstätige, der beherzt reagierte. Viele änderten aufgrund der Corona-Pandemie ihr Geschäftsmodell: Restaurantbetreiber stellten auf Lieferservice um. Änderungsschneidereien fertigten Atemmasken. Für einige hat sich daraus ein lukrativeres Geschäft ergeben als vorher oder zumindest ein zweites Standbein.
Für andere waren die Einschnitte durch Corona ein Anlass zu sagen: „Jetzt oder nie!", und längst überfällige Pläne umzusetzen. Für all diese Menschen brachte die Krise auch eine Chance. Die Pandemie, die für Hunderttausende Menschen Tod und Leid bedeutet, hat bei ihnen den Anstoß zur Veränderung gegeben.
„Wenn alles Äußere wegbricht, muss man sich selbst Halt geben", sagt Rommert. „Mir gelingt das, indem ich etwas tue." Am Anfang habe er nur nur sichtbar bleiben wollen, auch ohne Aufträge. Deshalb bot er über Facebook Gratistrainings für Onlinekonferenzen an. Schnell waren seine Dienste so gefragt, dass er darin ein Geschäft erkannte.
Rommert erklärt beispielsweise, wie man mehrtägige Präsenzveranstaltungen zu einem einzigen Zoom-Meeting eindampft, was man tun muss, um Menschen vorm Bildschirm bei der Stange zu halten, oder wie man dafür sorgen kann, dass sie bis zum Ende aufmerksam dabeibleiben. Zum Beispiel „ mit einem Whiskey-Tasting zum Ausklang", schlägt Rommert vor. Mit vorab verschickten Kostproben funktioniere das Gemeinschaftserlebnis auch, ohne dass die Teilnehmer ihre Bildschirme verlassen.
Zu Rommerts Kunden zählen vor allem Vereine, Behörden und Kirchen. Auch ein „Politiker-Speeddating" für eine Oberbürgermeisterwahl habe er schon ins Netz übertragen. Viele seien mit der technischen Umsetzung überfordert, meint er. Sein Geschäft boomt. Rommert rechnet aus, dass er seinen Umsatz gegenüber seinem alten Geschäftsmodell um eine Drittel ausbauen konnte. Mittlerweile müsse er sogar Aufträge ablehnen.
Auch der Berliner Galerist Johann König ist vom Ausfall von Veranstaltungen betroffen. Besonders schmerze ihn die Absage der Art Basel, die normalerweise dreimal jährlich stattfindet. In Basel selbst, in Miami und in Hongkong. Auch andere internationale Kunstmessen wurden dieses Jahr Corona-bedingt abgesagt. Kunsthändlern wie König fehlen damit wichtige Einnahmequellen.
Er hätte Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen können. „Stattdessen habe ich ihre Verkaufsprovision verdreifacht. Als Ansporn", sagt er. Denn er hatte zu dem Zeitpunkt schon große Pläne: „Wenn ich schon nicht auf Kunstmessen fahren kann, dann mache ich einfach meine eigene bei mir in der Galerie", habe er sich gedacht.
Im Juni lud er Künstler ein, Privatsammler, die ihrer Werke offerieren wollten, aber auch konkurrierende Galerien. Sie alle konnten bei ihm Kunstwerke zum Verkauf anbieten, wie auf einer normalen Messe eben. Groß genug ist seine zweistöckige Galerie in Berlin Kreuzberg, es handelt sich dabei um eine ehemalige Kirche. Statt Standmiete verlangte er für jeden abgeschlossenen Verkauf eine Provision.
Für König hat es sich gelohnt. 2,5 Millionen Euro Umsatz wurden auf der Messe gemacht. Trotz eingeschränkter Öffnungszeiten und limitierter Zutrittsmöglichkeiten zum Schutz vor Corona hatte die Messe König zufolge 4000 Besucher. Diejenigen, die nur die digitale Version online besuchten, nicht eingerechnet. König wird schon im kommenden Monat zum zweiten Mal seine Kunstmesse abhalten. Sie soll sich als dauerhafte Veranstaltung etablieren.
Die Krise als Geschäftsmodell„Menschen, die auch in der Krise eine Zukunftsperspektive für sich entwickeln", sind in den Augen von Oliver Stettes „Mutmacher für andere, die sich aktuell Sorgen machen, was mit ihrem Arbeitsplatz passiert. Auch wenn sie mit diesem gar nicht glücklich sind." Der Arbeitsmarktforscher vom Institut der deutschen Wirtschaft prognostiziert: „Es wird auch Menschen geben, die ihren Job verlieren und plötzlich die Möglichkeit entdecken, ihre Kompetenzen in Form einer Soloselbstständigkeit einzusetzen."
Schon jetzt sind es nicht nur Selbstständige, sondern auch Angestellte, die Corona als Anlass für Veränderungen nehmen. Nicht alle gehen dabei so unerschrocken vor wie Christopher Bieri. Im Frühling dieses Jahres, in einer Phase also, in der viele um ihren Job bangten, kündigte der 25-jährige Schweizamerikaner seinen unbefristeten Managerposten bei einer Münchener Unternehmensberatung.
Bieri will all seine Energie in sein junges Start-up stecken: Seatti, eine Onlineplattform, über die man ungenutzte Räume als flexiblen Arbeitsplatz mieten kann. Hotelzimmer zum Beispiel, die angesichts der zurückgegangenen Geschäftsreisen leer stehen.
„Airbnb für Working-Spaces" nennt Bieri das. Er ist der Meinung: „Große wirtschaftliche Umbrüche, wie wir sie momentan erleben, sind nicht die schlechtesten Startbedingungen für Start-ups." Und den Corona-bedingten Aufschwung der Remote Work habe er nicht vorüberziehen lassen wollen.
Die Idee kam ihm, als er in Amsterdam als Projektmanager für den E-Autobauer Tesla gearbeitet habe, so der Jungunternehmer. Denn dort seien die Mieten noch höher als in deutschen Großstädten: „Es kam mir zunehmend absurd vor, im Zeitalter von On-Demand-Booking 100 Prozent meiner teuren Miete zu bezahlen, obwohl ich wegen meines Jobs nur 30 Prozent der Zeit in meiner Wohnung verbrachte." Warum also nicht sein eigenes Wohn- und Arbeitszimmer als Coworking-Space vermieten, dachte er.
Ursprünglich konnte man über Seatti einen Arbeitsplatz in einer Privatwohnung mieten, deren Bewohner tagsüber außer Haus waren. Das ist hierzulande rechtlich jedoch nicht abgesichert. Derzeitige Verkaufsschlager sind die „Homeoffice-Hotelzimmer", die man über Seatti für nur 30 bis 40 Prozent des Übernachtungspreises mehrere Stunden am Tag anmieten kann. Aber auch Bars, Restaurants und Eventlocations, die tagsüber ungenutzt sind oder Corona-bedingt schließen mussten, kann man über die Webseite als Arbeitsplatz mieten. Rund 200 tageweise verfügbare Arbeitsplätze in 40 Städten im deutschsprachigen Raum gibt es aktuell.
Zum Beispiel Zimmer 406 im „25hours"-Hotel am Münchener Hauptbahnhof. Die antiquarisch anmutende Schreibmaschine und das Retrotelefon mit Wählscheibe als Deko auf der schmalen Schreibtischplatte karikieren geradezu den Eindruck eines modernen „Work-Spaces". Seatti-Mitbegründer Johannes Eppler sagt: „Die meisten Kunden kommen nicht auf der Suche nach einer idealen Arbeitsumgebung hierher, sondern weil sie Inspiration an einem anderen Ort oder kurzzeitig mal Ruhe vor dem Rest der Familie im Homeoffice suchen."
„Seatti kam genau im richtigen Moment um die Ecke", sagt Andreas Schnürer, Head of Sales bei der Hotelkette 25hours. „Wir konnten damit eine Lücke füllen und unkompliziert Zimmer zur Tagesnutzung zum Festpreis anbieten." Über Umsätze und das Transaktionsvolumen über Seatti wollen die Gründer keine Auskunft geben, weil sie „mitten in einer Finanzierungsrunde stecken", sagt Bieri. Er glaubt fest an seine Idee, weil er mit seinem Start-up einen Beitrag dazu leisten könne, dass Büroflächen zugunsten dringend benötigten Wohnraums verschwinden.
Doch die Ziele müssen gar nicht so hochgesteckt sein wie bei Bieri. In anderen Fällen hat Corona auch einfach nur den Freiraum für eine bessere Balance zwischen Arbeit und Privatleben gegeben. So wie bei Zora Neumann. Sie arbeitet im Vertriebsteam von „Mit Vergnügen", einer Berliner Digitalagentur. Während des Lockdowns fasste sie den Plan, nach zwölf Jahren zurück in ihre Heimatstadt Düsseldorf zu ziehen. Ihre ganze Familie lebt dort. Darunter auch die 95-jährige Oma. Neumann habe während des Lockdowns gemerkt, „ dass ich mich um meine Oma kümmern möchte, aber es ging nicht, weil ich zu weit weg wohne".
Schon im September steht der Umzug an. Ihren Job wird sie behalten. Von März an hätten sie und ihre Kollegen 100 Tage im Homeoffice gearbeitet. Alles habe so gut geklappt wie zuvor. Ihre Chefs haben daher nichts gegen den Wechsel von der Hauptstadt ins fast 600 Kilometer entlegene Düsseldorf.
„Von der neuen Wohnung aus werde ich mit dem Rad nur zehn Minuten zur Oma brauchen", sagt Neumann. Für die will sie künftig auch mal kochen und ihr beim Saubermachen helfen. „Familie kommt bei mir vor der Arbeit", sagt Neumann selbstbewusst. Durch Corona habe sie gelernt, ihre Bedürfnisse stärker in den Vordergrund zu rücken.
Eine Chance auch für ArbeitgeberDer Arbeitsmarkt könne vom flexiblen Arbeiten profitieren, prognostiziert Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. „Bislang war der Arbeitsort ein zentrales Kriterium bei der Jobauswahl. Wenn sich diese Einschränkung abschwächt, wird der Fokus noch stärker darauf liegen, ob Kompetenzen der Arbeitssuchenden und Anforderungen des Jobs wirklich passen."
Was das in der Praxis bedeutet, zeigt das Beispiel von Johanna Ronsdorf. Ein wichtiges Argument bei der Entscheidung für den Job bei Microsoft war für sie, dass sie dafür nicht umziehen musste.
„Meine Managerin und ich haben vereinbart, dass wir uns dafür zweimal in der Woche im Einzelgespräch intensiv digital austauschen. Und ich ein bis zweimal im Monat nach München fahre." Letzteres fällt seit März Corona-bedingt weg. Der digitale Austausch habe sich dagegen für alle intensiviert. Auch für ihre Münchener Kollegen, die sich sonst in der Kaffeebar trafen.
Negative Erfahrungen hat Microsoft mit dieser Regelung nach eigenen Angaben nicht gemacht. Im Gegenteil, die freie Ortswahl hilft dem Computerkonzern, für jede Stelle den bestmöglichen Bewerber auszusuchen, unabhängig von dessen Wohnort. Wenn andere Unternehmen diese Praxis jetzt übernehmen, dann bringt die Coronakrise nicht nur für manchen Beschäftigten einen positiven Anstoß zur Veränderung - sondern auch für die Arbeitgeber.
Mehr: Arbeitswelt nach Corona: Wie sieht das Büro der Zukunft aus?