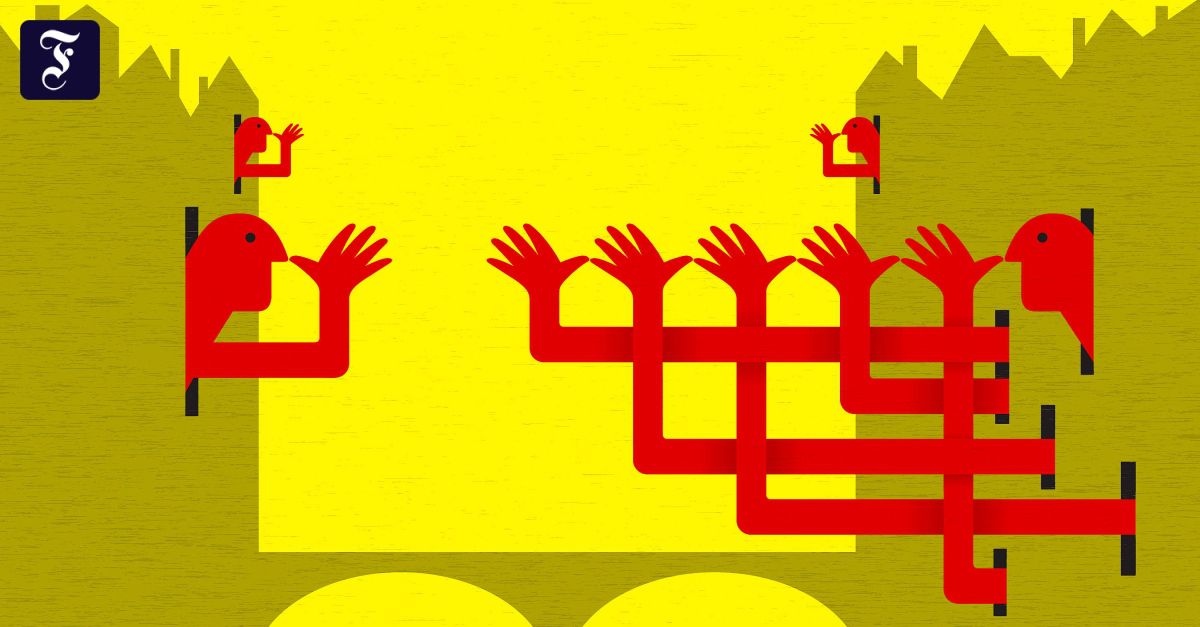Durch Deutschland laufen zahlreiche Grenzen, die wenigsten von ihnen sind sichtbar. Gehört zum Kartoffelsalat Mayonnaise oder ein Dressing aus Essig und Öl? Zwischen dem deutschen Norden und Süden scheiden sich da die Geister. Sprachräume teilen dieses Land ebenso wie der Weißwurstäquator und die Aldi-Nord-Süd-Linie. Auch vor der eigenen Haustür tun sich sprichwörtlich Gräben auf. Der eine Landkreis mag den anderen nicht, das Dörfchen schaut auf seinen Ortsteil herab, und die eine Stadt ist der anderen ein Graus. Und je näher sich zwei Orte sind, desto schlimmer.
So sagen die Mannheimer über ihre Nachbarn, dass das Schönste an Ludwigshafen die Brücke über den Rhein nach Mannheim sei. Ein Kölner würde lieber sterben, als das Düsseldorfer Altbier zu trinken - zumindest in der Theorie. Im Schwarzwald beäugen sich derweil in Villingen-Schwenningen, einer in den siebziger Jahren zusammengeschlossenen Doppelstadt, die Partner argwöhnisch. Die Villinger seien eingebildet, frotzeln die Schwenninger etwa auf der Straße. Umgekehrt rümpfen die Villinger über ihre Schwenninger Nachbarn die Nase. Und in Frankfurt wie in Offenbach gehört es zum guten Ton, der Nachbarstadt verbal stets eins mitzugeben.
Die Beispiele zeigen, wie Städter die Beziehung zum Nachbarn in Szene setzen: mit Witz und Folklore. Dabei werden kleine Unterschiede als zentral herausgestellt. Villingen ist badisch, Schwenningen liegt in Württemberg, Kölner rufen an Karneval Alaaf, in Düsseldorf schreien sie Helau, Mannheim ist kurfürstliche Residenz, Ludwigshafen hingegen Industriestadt. Riesige Unterschiede sind das nicht, vielmehr legt diese Erbsenzählerei nahe, dass die Nachbarn große Gemeinsamkeiten haben. Kein Wunder, stammen sie doch aus einer Region. Und mal ehrlich: Für die meisten Deutschen sind sowohl Kölsch als auch Altbier eine trübe Brühe, und weder Mannheim noch Ludwigshafen sind Urlaubsziele zum Träumen. Warum denkt also der eine, er sei besser als der andere? Woher kommt die Rivalität zwischen Nachbarn?
Der historische Blickwinkel macht etwas deutlichEs liegt nahe, die Antwort darauf im Beginn der Fehden zu suchen. Doch so einfach ist das nicht. „Der Ursprung der Rivalitäten zwischen einzelnen Städten ist nicht immer bekannt", sagt der Historiker Peter Johanek. Und wenn er das ist, verstehen die Bewohner einer Stadt ein historisches Ereignis nur selten als Grund für den gelebten Dualismus. Zwischen Köln und Düsseldorf wird oft das Stapelrecht von 1259 als Ursache für deren Zwietracht angeführt. Es zwang vorbeiziehende Händler, ihre Waren erst in Köln anzubieten. Das benachbarte und kleinere Düsseldorf bekam die Reste. „Wenn Sie einen Kölner heute auf der Straße nach dem Stapelrecht fragen, wird der Sie wohl verdutzt anschauen", sagt der emeritierte Professor und ehemalige Leiter des Instituts für vergleichende Städtegeschichte der Universität Münster.
Der historische Blickwinkel macht jedoch etwas deutlich: die Strahlkraft der Stadt als Erfolgsgeschichte. Ob Seuchen, Kriege oder Katastrophen, nichts konnte der Beliebtheit der Städte Abbruch tun. Immer versprachen sie Freiheit, und damit identifizierten sich die Menschen. Dank dieses Versprechens wuchsen die Städte und tun das noch immer. Mit der starken Identifikation aber setzt der Wunsch nach Prestige ein, erklärt Johanek. Denn wer möchte schon in einer Stadt leben, die einen schlechten Ruf hat?
Doch die Besonderheit der eigenen Stadt zu betonen ist schwer. Ungleich leichter ist es, die Unterschiede zu einer anderen herauszustellen. Man grenzt sich ab. Durch Zuschreibungen auf Kosten des anderen strahlt das eigene Licht umso heller. Zwei Beispiele: Wie lässt sich die Kölner Liebe zu ihrem Bier begründen? Indem betont wird, dass Kölsch besser ist als das Düsseldorfer Alt, obwohl beide obergärige Biere sind. Villingen hat eine schöne Altstadt, eine vergleichbare hat das benachbarte Schwenningen nicht. Was tun? Das weniger pittoreske Schwenningen verkehrt den Wert ins Gegenteil und wertet sich dadurch auf: Arroganz, wie sie die Villinger angeblich an den Tag legen, ist nicht gut. In Schwenningen wäre man niemals so eingebildet! Schon erscheint die eigene Stadt als die bessere.
Was ich nicht binDabei muss die Stadt, der man sich verbunden fühlt, keineswegs der Geburtsort sein. „Man identifiziert sich mit dem Ort, in den man sich eingebunden fühlt", sagt Johanek. Wer neu in eine Stadt kommt und sich wohl fühlt, geht auf die Suche, was sie ausmacht. Die Distinktionsmerkmale anderer werden zu den eigenen.
Die Abgrenzung ist ein natürliches Phänomen. „Bevor ein Kind ,ich' sagen kann, hat es die Beziehung zu den Eltern erkannt", erklärt die Soziologin Martina Löw. Der Mensch setze sich immer in Beziehung zu etwas anderem, was der Vergewisserung der eigenen Identität diene. Die Abgrenzung sei eine Ausprägung davon. Erst indem ich erkenne, was ich nicht bin, erkenne ich, was ich bin. Das zeigt sich auch bei den Städten. „Wer die Nachbarstadt verschmäht, will damit vor allem sagen, was die eigene Stadt ausmacht, und nicht, was die andere Stadt ist", erläutert Löw. Irgendwann kann der Vergleich zur Nachbarstadt selbst zur Identität einer Stadt gehören.
Die Soziologin erforscht den urbanen Raum, den sie nicht nur als Lebensort der Menschen, sondern auch als prägende Größe ansieht. „In Städten bilden sich Weltsichten heraus, die typisch für sie sind. Die bestehen nicht nur in den Köpfen der Bewohner, sondern beeinflussen den gesamten Alltag", sagt Löw. Das nennt sie die Eigenlogik der Städte. Eine Stadt entwickelt also Strukturen, die ihre Bewohner verinnerlichen. Das kann die Rivalität zum Nachbarn sein oder auch etwas anderes. Wie nehmen Menschen zum Beispiel Zeit wahr? Das unterscheidet sich zwischen Städten. Die Berliner Professorin hat herausgefunden, dass Dortmunder eher vergangenheitsbezogen denken, Frankfurter hingegen zukunftsorientiert. Als Folge experimentiere man in Frankfurt stärker mit Öffnungszeiten, was wiederum einen Einfluss auf die Zeitwahrnehmung hat. Die Stadt prägt also ihre Bewohner, die Bewohner beeinflussen aber auch ihre Stadt. Ein wechselseitiges Verhältnis.
Auch die Lokalrivalitäten prägen Stadt und Bewohner wechselseitig. „Zur Eigenlogik einer Stadt kann gehören, wie stark ich eine Rivalität betone und wie ich sie in Szene setze", sagt Löw. Ausgelebt wird das etwa durch Bräuche, Gepflogenheiten oder Witze. Einen ursächlichen Grund gibt es dafür nicht mehr. Zwischen benachbarten Städten besteht oft seit Jahrhunderten eine Konkurrenz. „Das schreibt sich tief in das kollektive Bewusstsein ein", sagt die Soziologin. Es gibt Werke von Schriftstellern, Reden von Politikern oder Zeitungsartikel über die Unterschiede zur Nachbarstadt: Texte konservieren Wissen. Das geben die Menschen untereinander weiter. Die Rivalität wird zum Teil der Stadt.
Bewohner werden MarkenbotschafterDoch warum kabbeln sich Städte gerade mit ihren Nachbarn? Löw spricht von einem „Spiel der Zugehörigkeit und Abgrenzung". Für die Identität Kölns und Düsseldorfs ist das Rheinland zentral. In Anbetracht der Gemeinsamkeit müssen sie die Unterschiede betonen, um das Eigene zu wahren.
Sich vom Nachbarn abzugrenzen ist auch aus wirtschaftlicher Perspektive sinnvoll, weiß Sabine Kuester. Die Professorin für Marketing vergleicht die Stadt mit einem Markt. Untereinander konkurrieren die Städte um die gleichen Ressourcen - etwa Bewohner, Arbeitgeber oder Touristen. Je ähnlicher sich Städte sind oder je näher sie beieinander liegen, desto intensiver ist der Wettbewerb. Man muss sich gegeneinander positionieren. „Manche Städte haben es da einfacher als andere", sagt die Mannheimer Professorin. Wenn man eine Stadt als Marke versteht, haben manche einen höheren Markenwert als andere. Je höher der ist, desto weniger Marketing muss eine Stadt betreiben. „Wird eine Marke als einzigartig wahrgenommen, ist Abgrenzung überhaupt nicht mehr nötig", sagt Kuester.
Städte, die in Deutschland anders als etwa Berlin und München kein Alleinstellungsmerkmal haben, müssen für sich werben. Die Bewohner werden unbewusst zu Markenbotschaftern, denn jeder möchte in einer erfolgreichen Stadt leben. So betonen sie fleißig die Vorteile des eigenen Wohnorts - oder die Nachteile des Wettbewerbers. Denn das ist besonders einprägsam. In der Produktwerbung war das in Deutschland übrigens lange Zeit verboten. Doch nun darf Pepsi auch hierzulande Cola verschmähen, und Menschen mampfen schmerzverzerrt Burger der einen Fastfoodkette in der Werbung der anderen.
Womit wir wieder beim Essen wären. Alt oder Kölsch? Kartoffelsalat mit oder ohne Mayo? Das sagt mehr über die Deutschen aus, als man zunächst denken würde.