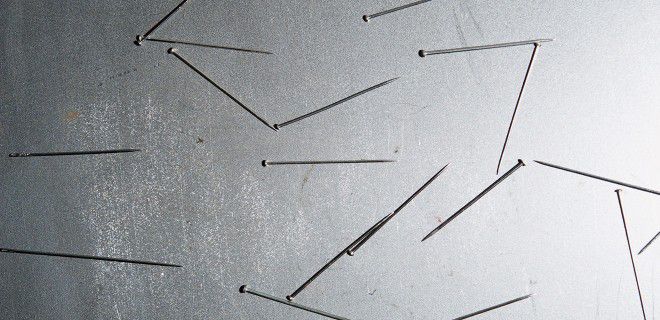Maria, 21, empfindet tiefe Befriedigung, wenn sie sich schneidet. Wie eine Bestrafung, die sie genießt
Schmerz ist für mich ein wohltuendes Gefühl – so, als habe bei mir
jemand etwas falsch programmiert und Schmerz und Liebe verwechselt. Ich
falle dabei in eine Art Trance, ich stehe dann neben mir und gucke mir
beim Schneiden zu, ein dissoziativer Zustand.
Seit ich vor vier Monaten in die Klinik kam, versuche ich, mich nicht
mehr so häufig zu schneiden. Mit vier, fünf Malen bin ich bisher
ausgekommen. Es war mir jedes Mal sehr peinlich, weil man danach den
Pflegern Bescheid sagen muss. Aber manchmal ertrage ich es einfach nicht
mehr länger: Wenn ich meine Regeln nicht eingehalten habe, zum Beispiel
eine bestimmte Gramm- oder Kalorienzahl beim Essen überschritten oder
in der Therapie zu viel preisgegeben habe, muss ich mich bestrafen.
Schneiden ist dafür die einfachste Möglichkeit. Es geht schnell, und man
kann es überall machen. Bevor ich damit anfange, fühle ich mich immer
wie jemand, der eine Woche nichts gegessen hat. Er hat das Steak schon
auf dem Teller und wartet nur darauf, dass er loslegen darf. Ich mache
es mir in meinem Zimmer bequem, schalte Musik ein – Punkrock, Queen oder
nur Radio – und hole ein Handtuch, Verbandszeug, Desinfektionsmittel
und Rasierklingen. Wenn ich all das neben mir angeordnet habe, kommt der
erste Schnitt.
Wenn die schnitte gut geworden sind, hält die Befriedigung an
Ich schneide immer in meine Unterarme. Pro Session müssen es mindestens
zehn Schnitte sein, je mehr, desto besser. Ich muss in einer
bestimmten Anordnung schneiden, die zu den vorherigen Schnitten passt.
Wenn die Schnitte gut geworden sind und ich Glück habe, hält die
Befriedigung nach der Session noch eine Weile an.
Vielleicht klingt das, als sei Schneiden für mich eine Belohnung, keine
Bestrafung. Aber das ist es nicht. Es ist einfach meine Methode, mich
selbst auszuhalten. Manche versuchen, mit Ersatzhandlungen davon
loszukommen, Chilis kauen, auf Erbsen laufen, kalt duschen. Ich halte
das für Scheiß. Wenn ich dazu in der Lage bin, etwas anderes zu tun, bin
ich auch in der Lage, es ganz seinzulassen.
Wann ich mit dem Schneiden angefangen habe, weiß ich nicht mehr.
Vielleicht mit zwölf, als sich meine Eltern getrennt haben. Meine
Einstellung zu Schmerzen war aber schon als Kind anders als bei den
meisten. Mein Vater langte gern mal zu, allerdings habe ich das nie als
negativ empfunden. Manchmal habe ich ihn sogar extra provoziert. Schmerz
war etwas Tolles. Es war Zuwendung. Mit meiner Mutter habe ich bis
heute nicht wirklich über das Schneiden geredet. Sie hat es wohl erst
erfahren, als mich das Internat in eine Klinik geschickt hat.
Dies ist mein vierter Klinikaufenthalt, denn leider reicht Schneiden
nicht mehr aus. Ich treffe jetzt Männer, von denen ich ahne, dass sie
mir Gewalt antun werden. Das ist gefährlich. Trotzdem hat es keinen
Sinn, damit aufhören zu wollen, solange ich nicht gelernt habe, mit mir
selbst klarzukommen.
Original