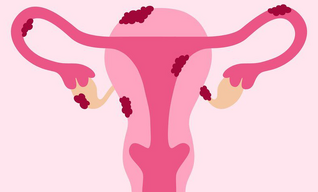Stefanie Uhrig
Erbach
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Stefanie Uhrig
-
biologie
-
medizin
-
psychologie
-
online
-
print
-
gehirn
-
neurowissenschaften
-
podcasting
-
klimapsychologie
Persönliches
Mit meinem Mann und meinen zwei Kindern wohne ich im schönen Odenwald. Neben meiner Vorliebe für verschiedene Sportarten engagiere ich mich bei Kiwanis, einer internationalen Organisation, die sich für das Wohl der Kinder einsetzt.
Mein Weg zum Journalismus...
... war nicht sehr gradlinig. Begonnen habe ich mit einem Biologiestudium (BSc.), dann einem Master in Molecular Biosciences, bis zur Promotion in den Neurowissenschaften. Für meine Doktorarbeit war ich in der Suchtforschung am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, wo ich mein Interesse an der Psyche mit ihrer Einzigartigkeit und ihren Tücken gefunden habe. 2016 begann ich ein Fernstudium "Journalismus" und 2018 wagte ich den Schritt, meine Liebe zum Schreiben mit der Begeisterung für das menschliche Gehirn und dem Wissensdurst zu vereinen und den Weg als freie Wissenschaftsjournalistin anzutreten.
Kurzinfo
Ich arbeite seit 2018 als Freie Wissenschaftsjournalistin für Print, Online, mittlerweile auch Audio. Meine Schwerpunkte liegen in den Neurowissenschaften, Psychologie, Medizin und Biologie.
Seit 2022 hoste ich zudem den Podcast "Klima&Ich" über die Psychologie der Klimakrise, gemeinsam mit der Psychologin Sabrina Krauss.
Auftraggeber
Der Tagesspiegel , Planet Wissen , VRM Medien , dasgehirn.info , doccheck.com , psychologie-heute.de , quarks.de , spektrum.de , taz
Weitere Profile
@[email protected] , Facebook , LinkedIn , Xing
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track