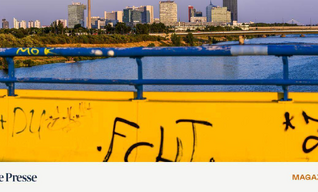Solmaz Khorsand
Wien
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Solmaz Khorsand
-
europa
-
österreich
-
reportagen
-
iran
-
storytelling
-
magazinjournalismus
Hat als Redakteurin bei der Wiener Zeitung gearbeitet, beim Monatsmagazin Datum, standard.at, Republik und war ebenso Mitverantwortliche der Ö-Seiten der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Nach ihrem Abschluss an der FH für Journalismus in Wien hat sie zusätzlich ein zweijähriges Studium in Internationalen Beziehungen an der Johns Hopkins University in Bologna und Washington D.C absolviert. Zu ihren Auslandsstationen zählen Dublin, New York, Kabul und Teheran. Sie spricht neben Deutsch und Englisch auch Persisch und Französisch. Im Februar 2021 erschien ihr Buch "Pathos" im Verlag "Kremayr&Scheriau". Ihre Artikel erscheinen zudem im Falter, im Spiegel, in der NZZ, der WOZ, der Taz, Profil u.a. Im Februar 2024 erscheint ihr Buch "untertan. Von braven und rebellischen Lemmingen." (Leykam Verlag)
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track