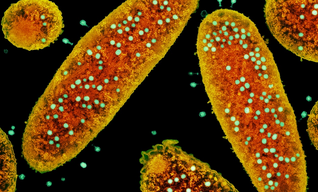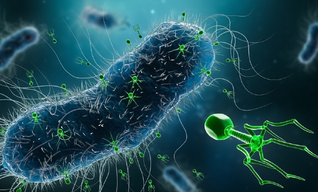Ruth Eisenreich
Wien
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Ruth Eisenreich
-
gesellschaft
-
gesundheitspolitik
-
österreich
-
soziales
-
gendermedizin
-
geschlechtsspezifische medizin
Ich bin freie Journalistin in Wien und arbeite am liebsten zu Themen am Schnittpunkt zwischen Medizin, Politik und Gesellschaft. Mich interessiert, welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf das Leben von Menschen haben, wo Dinge schieflaufen und wie es besser gehen kann – ob in Deutschland, Österreich oder im Ausland.
Ich habe an der FH Wien das journalistische Arbeiten gelernt, ein Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung gemacht und war Redakteurin bei der Wiener Wochenzeitung Falter und bei der Zeit. Seit Ende 2018 arbeite ich frei. 2019 habe ich mit einem Stipendium der Internationalen Journalistenprogramme (IJP) drei Monate als freie Brasilien-Korrespondentin in São Paulo verbracht.
Auftraggeber
Bild der Wissenschaft , Brigitte , Chrismon , Datum , Der Spiegel , Deutschlandfunk , Die Zeit & Zeit Online , Drahtesel , Eurotopics , Falter , NZZ am Sonntag , Profil , Republik , Science Notes , Spektrum.de , Süddeutsche Zeitung & SZ.de & SZ-Magazin.de , Tagesspiegel , Zeit Campus , taz , Ö1
Weitere Profile
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track