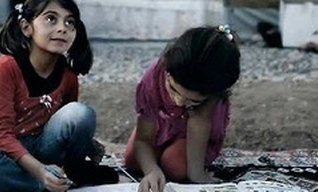Peter Neitzsch
Hamburg
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Peter Neitzsch
-
arbeitsrecht
-
beruf
-
bildungspolitik
-
finanzen
-
hochschule
-
nachrichten
-
verbraucher
-
wirtschaft
-
karriere
-
energiepolitik
-
ngo
-
online-journalismus
-
fundraising
Zur Sache
Peter Neitzsch schreibt über Wirtschaft und Politik, Reisen und Menschen und die Schnittmengen. Neben Analysen, Berichten, Reportagen und Interviews aus dem In- und Ausland liefert er auch die dazugehörigen Fotos.
Seine Spezialgebiete sind Finanzen, Versicherungen, Beruf und Karriere sowie Non-Profit-Organisationen.
Zur Person
Der Journalist lebt in Hamburg, dort arbeitet er als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Impulse. Als Freiberufler schrieb er unter anderem für Finanztip.de, UNI SPIEGEL und den dpa-Themendienst und bereitete Nachrichten am Newsdesk von tagesschau.de auf.
Zuvor verantwortete der Absolvent der Berliner Journalisten-Schule (BJS) das Wirtschaftsressort von stern.de und betreute als Multimedia-Redakteur den Online-Auftritt und die Tablet-Ausgabe der Frankfurter Rundschau.
Der Arbeit als Journalist ging ein sozialwissenschaftliches Studium in Dresden und Paris voraus sowie längere Aufenthalte in Südafrika.
Auftraggeber
Audimax , Berliner Zeitung , Finanztip , Frankfurter Rundschau , Fundraiser Magazin , Hamburger Abendblatt , Leipziger Volkszeitung , Spiegel Online , Stuttgarter Nachrichten , Sächsische Zeitung , Tagesspiegel , XING Spielraum , dpa-Themendienst , heute.de , impulse.de , jetzt.de , news.de , stern.de , tagesschau.de
Weitere Profile
Freischreiber , Twitter , Xing , kress.de
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track