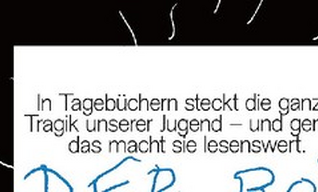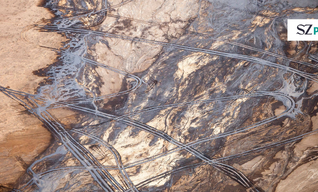Martin Hogger
München
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Martin Hogger
-
gesellschaft
-
musik
-
wirtschaft
-
reportagen
Weitere Profile
Facebook , Instagram , Twitter
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track