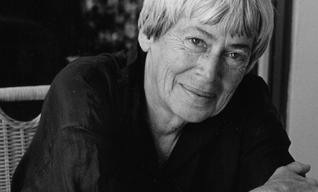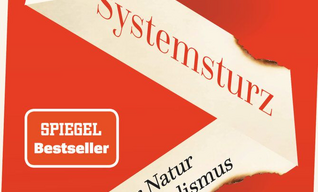Marlon Lieber
Frankfurt/Main
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Marlon Lieber
-
technologie
-
kapitalismus
-
marxismus
-
amerikanische kultur
-
kritische theorie
-
amerikanische literatur
Über mich
Ich bin als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für England- und Amerikastudien der Goethe-Universität Frankfurt angestellt, wo ich 2018 mit einer Arbeit über den afro-amerikanischen Schriftsteller Colson Whitehead promoviert wurde. 2023 erschien mein erstes Buch »Reading Race Relationally: Embodied Dispositions and Social Structures in Colson Whitehead's Novels« beim transcript Verlag.
Neben akademischen Texten über amerikanische Literatur und Kultur schreibe ich hin und wieder Buchrezensionen, Essays und andere Texte für Zeitschriften und Magazine wie »analyse und kritik« oder »Geschichte der Gegenwart«.
Auftraggeber
Geschichte der Gegenwart , Jacobin US , Soziopolis , analyse & kritik
Weitere Profile
Instagram , Persönliche Website , Twitter
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track