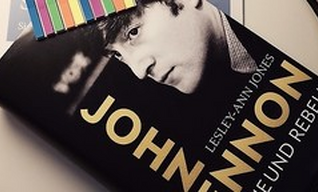Lisa Berins
Frankfurt und Offenbach
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Lisa Berins
-
gesellschaft
-
kultur
-
kunst
-
leute
-
zeitgeschehen
Kurzbiografie
Lisa Berins ist Feuilleton-Redakteurin der „Frankfurter Rundschau“ und berichtet schwerpunktmäßig über bildende Kunst, Kulturpolitik und Künstliche Intelligenz. Beachtung fanden in jüngster Zeit ihre kritische und differenzierte Berichterstattung zur documenta fifteen, ihre aufdeckenden Recherchen über die Verteilung von Bundesfördergelder und ihre hintergründigen Analysen und Interviews zur Künstlichen Intelligenz und ihren Auswirkungen auf den Kulturbetrieb.
Auf der Frankfurter Buchmesse 2023 moderierte sie die Podiumsdiskussion „Künstliche Intelligenz – wie wird sie das Schreiben und die Buchbranche verändern?“, auf die sich mehrere Medienberichte bezogen.
Immer wieder befasst sich die Journalistin mit aktuellen Debatten, unter anderem mit einem wachsenden Antisemitismus in der Kulturbranche und mit feministischen Perspektiven auf die Kunstgeschichte.
Ihre aktuellen Artikel sind zu lesen unter: www.fr.de/suche/?tt=1&tx=&sb=&td=&fd=&qr=Lisa+Berins (ohne Paywall).
Ihre journalistische Laufbahn hat Lisa Berins nach dem Magister-Studium der Kunstgeschichte und Journalistik an der Universität Leipzig bei der „Leipziger Volkszeitung“ begonnen. Zwei Jahre lang arbeitete sie als Kulturredakteurin bei der „Thüringischen Landeszeitung“ in Weimar, von 2016 bis 2022 war sie bei der Tageszeitung „Offenbach-Post" als Kulturredakteurin für die kulturelle Berichterstattung aus der Region zuständig. Seit Mai 2022 ist sie als Redakteurin im Feuilleton der "Frankfurter Rundschau" beschäftigt. Im Juni 2023 wurde sie in den Vorstand des Journalistinnenbundes (JB) Deutschland gewählt.
Lisa Berins wohnt nahe Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet.
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track