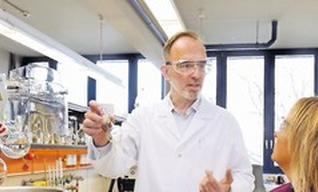Katja Edelmann
Speyer (Rhein-Neckar)
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Katja Edelmann
-
beruf
-
bildung
-
frauen
-
gesellschaft
-
soziales
-
unternehmertum
-
wirtschaft
-
corporate publishing
-
technologie
-
entrepreneurship
-
familienpolitik
-
kindheitsforschung
Profil
Menschlich, überblickend, vergleichend - so recherchiere, schreibe und konzipiere ich für Institutionen, Verlage und Unternehmen. Als Kommunikationswirtin und Journalistin verbinde ich Wirtschaftsthemen mit Sozialem, Schulen mit Betrieben oder Forschungsinstitute mit Unternehmen. Ich verfolge Zukunftsthemen und bin oft auf Kongressen zu finden.
Medien
Online, Social Media, Print
Sprachen und Länder
Deutsch, Spanisch, Englisch, etwas Portugiesisch.
Erfahrung in Spanien, Schweden, Brasilien
Auftraggeber
Audimax , OCLC , igbce.de , kliba-heidelberg.de , rheinpfalz.de
Weitere Profile
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track