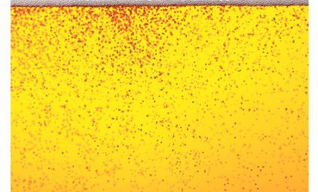Katharina Kropshofer
Wien
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Katharina Kropshofer
-
sozialwissenschaften
-
umwelt
-
wissenschaft
-
klimawandel
-
ökologie
Auszeichnungen
Georg-Schreiber-Medienpreis 2018
Evidenzbasierte Medizin in den Medien 2018
Shortlist "Reporterpreis 2018"
Shortlist "Nannen-Preis 2018"
Für "Das Scheingeschäft" erschienen in: Süddeutsche Zeitung Magazin
Stipendien
Stipendium "Forschung& Journalismus" 2019: Österreichische Akademie der Wissenschaften
Publication Support Scheme - Investigative Journalism for Europe (EJC) 2020
Literar Mechana Stipendium 2020
Weitere Profile
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track