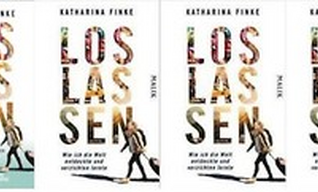Katharina Finke
Berlin
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Katharina Finke
Katharina Finke (*1985) ist Sachbuch-Autorin und freie Investigativ-Journalistin. Sie berichtet von verschiedenen Orten auf der Welt. Bislang aus Argentinien, Armenien, Azerbaijan, Australien, Bangladesch, Belgien, Chile, China, Costa Rica, Deutschland, Indonesien, Indien, Island, Israel, Italien, Frankreich, Ghana, Griechenland, Kanada, Kolumbien, Myanmar, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Thailand, Türkei, Uruguay, UK und den USA. Ihre Schwerpunkte sind Umwelt & Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Reise und Frauen mit Fokus auf sozialen Projekten und Menschenrechtsthemen.
Sie arbeitet für Print- und Onlinemedien, sowie als Autorin, Cutterin, Producerin und Stringerin für Bewegtbildformate. Zudem hat sie Erfahrungen mit internationalen Medienhäusern gesammelt und investigativen Cross-Border-Recherchen gemacht. Sie kann als Speakerin, Moderatorin, Live-Journalismus-Act gebucht werden. Außerdem hat sie ich verschiedene Konferenzen organisiert mit dem Schwerpunkt: inhaltliche Programmgestaltung.
2015 ist ihr erstes Sachbuch "Mit dem Herzen einer Tigerin“ bei HEYNE erschienen, in dem es um Gewalt gegen Frauen geht. In „LOSLASSEN – Wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte“ erzählt Finke von ihrem minimalistischen Lebensstil und ihren Reisen rund um den Globus. Es ist im März 2017 bei PIPER/MALIK erschienen und wurde 2020 von National Geographic neu aufgelegt. Sowie: “LOSLEBEN – Vom Mut, loszulassen und als Familie die Welt zu entdecken”, erschien 2021 auch bei Piper/Malik und wurde mit dem ITB Book Award 2022 ausgezeichnet.
Languages
Deutsch (Muttersprache, Latein (großes Latinum), English & Spanisch (verhandlungssicher), Portugiesisch (gut), Französisch & Italienisch (Grundkenntnisse)
Auftraggeber
Brigitte.de , Caixin , Correctiv , DW , Effilee , Emotion slow , Forschung & Lehre , Fräulein Magazin , FvF , Globetrotter Magazin , Greenpeace Magazin , KULTURZEIT (3sat) , Kulturmontag (ORF) , Kulturplatz (SRF) , MERIAN , Natur , PANTA magazine , PULS , Piper , Publik Forum , Random House - HEYNE , SPIEGEL ONLINE , SPIEGEL TV , Seventeen Goals Magazin , SpiegelWissen , Stimmen aus China , Süddeutsche Zeitung , TV Hören & Sehen , Theo Magazin , VOCER , Yoga Jorunal , ZDF login , ZEIT , Zeitschrift Arbeitsmarkt Umweltschutz & Naturwissenschaften , arte , der Freitag , enorm Magazin , nano (3sat) , netzwerk recherche , probono tv , stern.de , taff (ProSiebenSat1) , taz - die Tageszeitung , ttt (ARD)
Weitere Profile
Facebook , instagram , twitter
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track