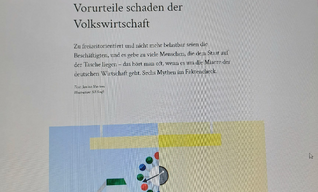Janina Martens
Berlin
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Janina Martens
-
nachhaltigkeit
-
reportage
-
umwelt
-
wirtschaft
-
constructive journalism
Über mich
Reportagen, Reports und Porträts, insbesondere über Visionär:innen und deren Ideen für mehr Nachhaltigkeit, eine zukunftsfähige Wirtschaft und Gesellschaft.
Ausgebildet zur Journalistin u.a. an der Reportageschule Reutlingen.
Auszeichnungen und Stipendien:
-Medienpreis Wirtschaft NRW 2021 für die Reportage "Der Geist von Höxter", erschienen in der "brand eins"
-Ernst-Schneider-Preis 2022 in der Kategorie "Starterpreis" für herausragende Nachwuchsjournalist:innen im Wirtschaftsjournalismus
-2024: 2-monatiger Stipendienaufenthalt in Riga (Lettland) im Rahmen des IJP - Internationalen Journalisten Programms für Nordeuropa
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track