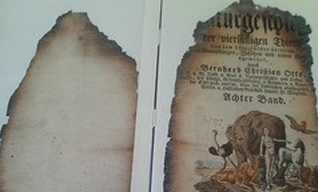Iris Milde
Dohma
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Iris Milde
-
feature
-
norwegen
-
polen
-
sachsen
-
soziales
-
tschechien
-
wirtschaft
-
reportagen
-
hintergrundreportagen
-
baudenkmäler und kunstgeschichte
-
umwelt- und verbraucherthemen
Kurz zu mir
Beheimatet bin ich als freie Journalistin im Hörfunk. In erster Linie berichte ich für den Deutschlandfunk. Ab und zu bin ich aber auch im Printbereich unterwegs. Bevor ich mich 2013 in Dresden niederließ, habe ich reichlich drei Jahre im schönen Prag gelebt und als Freie für Radio Prag, das ARD-Hörfunkstudio in Prag, die Sächsische Zeitung und die Landeszeitung gearbeitet. Fachlich schöpfe ich aus meinem Journalistikstudium in Leipzig, wo ich auch Übersetzen für Tschechisch und Polnisch studiert habe, aus Praktika/Hospitationen bei Radio Prag, Deutschlandfunk und dem ARD-Hörfunkstudio Stockholm und meiner langjährigen Erfahrung als Journalistin "auf freiem Fuß" (wie man auf Tschechisch so treffend sagt).
Auftraggeber
MDR , ard.de , deutschlandradio.de , landeszeitung.cz , radio.cz , sz-online.de
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track