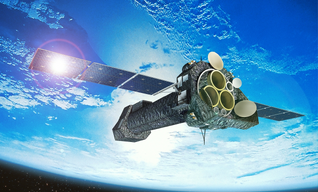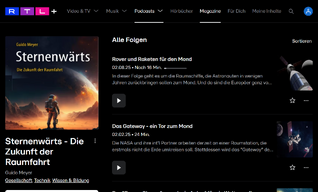Guido Meyer
Bonn
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Guido Meyer
arbeite als Freier Journalist mit Schwerpunkt Weltall/Raumfahrt überwiegend für die Hörfunkanstalten der ARD, beackere bisweilen aber auch Medien- und Reisethemen
Auftraggeber
"Die Welt" , "Neue Zürcher Zeitung" , "Space Magazine" , "VDI Nachrichten" , ARD-Hörfunk
Weitere Profile
"Sternenwärts - Die Zukunft der Raumfahrt" , Facebook , X
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track