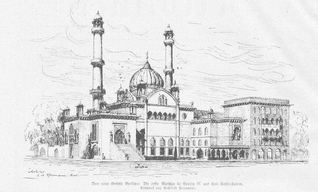Fabian Goldmann
Berlin
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Fabian Goldmann
-
flüchtlinge
-
islam
-
rassismus
-
syrien
-
nahost
-
islamismus
-
islamfeindlichkeit
-
antimuslimischer rassismus
-
islamophobie
Auftraggeber
Der Freitag , Focus , Migazin , Qantara , Spiegel Online , Telepolis , The Huffington Post , Wiener Zeitung , Zeit Online , neues deutschland , taz
Weitere Profile
Blog , Facebook , Insta , Twitter
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track