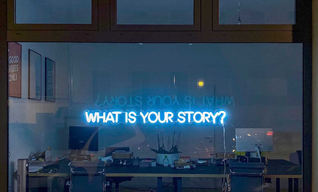Michael Brüggemann
Mainz
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Michael Brüggemann
Michael Brüggemann, geboren 1976, studierte Architektur in Detmold und merkte, dass ihm das Schreiben darüber noch mehr Spaß macht. Wie man mit Schreibblock und Mikro umgeht, lernte er am Journalistischen Seminar der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und durch Praktika und freie Mitarbeit bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung/Sonntagszeitung, der Deutschen Bauzeitschrift, Südwestrundfunk und Mainzer Rheinzeitung.
Michael Brüggemann schreibt über Städte, Häuser und ihre Gestalter: Architekten und Ingenieure, die dem Klang der Stadt nachspüren, sich von Pflanzenhalmen inspirieren lassen oder im Meer einen neuen Dämmstoff entdecken. Er recherchiert zu Energie- und Nachhaltigkeitsthemen, erkundet aber auch gern ungewohntes Terrain abseits seiner Fachgebiete: Michael hat jugendliche Schläger beim Anti-Aggressions-Training begleitet oder ist mit einem blinden Bergsteiger in den Alpen geklettert.
Seit 2006 arbeitet der gebürtige Ostwestfale als Redakteur, seit 2018 als Textchef der Agentur trurnit sowie als freier Autor und Schreibcoach. Seine Texte sind u.a. erschienen im Stern, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung/Sonntagszeitung und natur.
Michael gibt sein Wissen über das Schreiben gerne weiter. Seit knapp zehn Jahren konzipiert und moderiert er Schreibworkshops zu Themen wie Storytelling, schöner Schreiben, originelle Texteinstiege oder Texte redigieren mit KI. Er hat mehr als ein Dutzend Schreibseminare entwickelt und trainiert Volontär:innen und Redakteur:innen ebenso wie freie Journalist:innen und Kommunikationsprofis von Medienakademien, Verbänden und Organisationen.
Michael ist Mitglied bei Freischreiber e.V. Auszeichnungen: BCP-Award 2010 als Redakteur und Projektleiter für das Kundenmagazin von Entega, 2006 Auszeichnung beim "Hessischen Preis für junge Journalisten".
Auftraggeber
capital.de , faz.net , hoffmann-und-campe.de , natur.de , stern.de , sueddeutsche.de , sz-scala.de , trurnit.de
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track