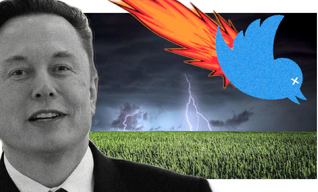Chris Köver
Berlin
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Chris Köver
-
datenschutz
-
künstliche intelligenz
-
politik
-
überwachung
-
asyl
-
feminismus
-
tech
-
netzpolitik
-
flucht
-
netzkultur
-
digitale gewalt
-
algorithmic bias
-
bildbasierte gewalt
-
pornoplattformen
-
automatisierte entscheidungen
Chris Köver ist seit 2018 Redakteurin bei netzpolitik.org. Sie recherchiert unter anderem zu Digitaler Gewalt, so genannter Künstlicher Intelligenz und zur Migrationskontrolle.
Sie ist Mit-Gründerin und war bis 2014 Mit-Chefredakteurin des Missy Magazine.
Auszeichnungen:
2021 Journalistenpreis Informatik für die Recherche "Tiktoks Obergrenze für Behinderungen"
2014 Arthur F. Burns Fellowship der Internationalen Journalistenprogramme
2013 Medium Magazin Top Ten Redaktionen des Jahres
2009 Medium Magazin Journalistin des Jahres in der Kategorie "Newcomer"
Auftraggeber
Die Zeit , Dradio Wissen , Emotion , Neon , Spiegel Online , Vice , WIRED Germany , Zeit Campus , myself.de , taz
Weitere Profile
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track