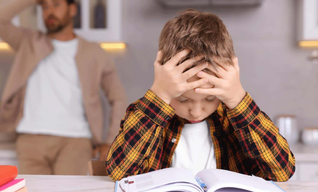Birk Grüling
Hamburg
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Birk Grüling
-
familie
-
gesellschaft
-
gesundheit
-
reportage
-
soziales
-
sport
-
technik
-
wissenschaft
-
popkultur
-
crossmedial
-
jugend
-
menschen mit behinderung
-
robotik
-
dinosaurier
-
kindermedien
Über mich:
Als Kind wollte ich unbedingt Forscher werden. Umwege führten mich aber schließlich zum Schreiben. Meine Leidenschaft für ausgestorbene Tiere, versunkene Kulturen und verrückte Erfindungen blieb jedoch bestehen. Als Wissenschaftsjournalist und Kinderbuchautor kann ich sie zum Glück voll ausleben. Neben dem Buchschreiben arbeite ich für RND, PM Magazin, taz, dpa-Kindernachrichten, Brigitte oder die WDR Maus zum Hören.
Bücher:
2021: Eltern als Team (Kösel Verlag)
2022: Am Arsch der Welt und andere spannende Orte (Klett Kinderbuch)
2022: Mama, Papa, was macht wir heute? (Leben und Erziehen/Edel Books)
2022: Ein T-Rex namens Sue. Dinosaurier und ihre Entdeckerinnen (Klett Kinderbuch)
2024: Felicitas und Jakob. Ein Sommer in den Herrenhäuser Gärten.
2025: SchlauFUX Unsere Erde (Kosmos Verlag)
2025: SchlauFUX Dinosaurier (Kosmos Verlag)
2025: "Muss das sein?!" Von Brokkoli, Anzugtagen und Glitzerregen (ASB)
Stipendien und Auszeichnungen:
2025: "Gartenbuch des Jahres" in der Kategorie "Kinderbuch" für Felicitas und Jakob. Ein Sommer in den Herrenhäuser Gärten
2023: „Am Arsch der Welt“ wurde ausgezeichnet als White Ravens 2023 von der Internationalen Jugendbibliothek
2022: Jugendsachbuchpreis 2022 für "Am Arsch der Welt"
2022: EMYS-Sachbuchpreis im Oktober 2022 für "Am Arsch der Welt"
2022: Nominierung für Wissenschaftsbuch des Jahres 2023 (Longlist) für "Ein T-Rex namens Sue"
2021: Stipendium Neustart Kultur für ein T-Rex namens Sue
2017: Schöpflin-Stipendium für lösungsorientierten Journalismus zum Thema "Familie 2020"
2014: Top 30 bis 30 Nachwuchsjournalisten - Preis vergeben vom Medium Magazin
Weitere Profile
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track