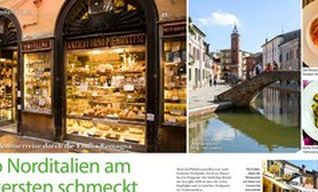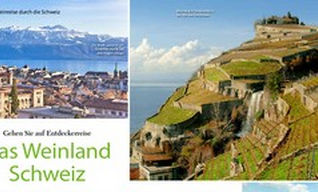Ann-Christin Baßin
Hamburg
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Ann-Christin Baßin
-
ernährung
-
feature
-
fotografie
-
gesundheit
-
interview
-
psychologie
-
corporate publishing
-
reportagen
-
food
-
lektorat
-
foodfotografie
-
reisereportagen
-
entwicklungsredaktion
-
sprecherin (erklärvideos
Auftraggeber
FOUR , Hubert Burda Media , Lust auf Landküche , Rezepte mit Herz , foodizm , stern
Weitere Profile
Freischreiber , acbassin.com , acbassin.de
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track