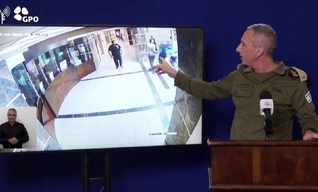Alexander Schmitt
-
Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Alexander Schmitt
-
ausland
-
gesellschaft
-
integration
-
kirche
-
konflikte
-
krieg
-
migration
-
nachrichten
-
polen
-
politik
-
russland
-
ukraine
-
video
-
panorama
-
frieden
-
verteidigungspolitik
-
ukraine-krieg
-
katholische kirche
-
sicherheitspolitik
-
internationale politik
-
krisen
-
ukrainekrieg
-
bundespolitik
Auftraggeber
DER SPIEGEL , Erzbistum Hamburg , FREIHAFEN , Journalistenschule ifp , Neue Kirchenzeitung , Politikorange , RND – RedaktionsNetzwerk Deutschland , Stuttgarter Zeitung , ZDF – Zweites Deutsches Fernsehen , feinschwarz.net
Weitere Profile
DER SPIEGEL – Autorenseite , Instagram , LinkedIn , Twitter , Website , Xing
Fehler!
Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track