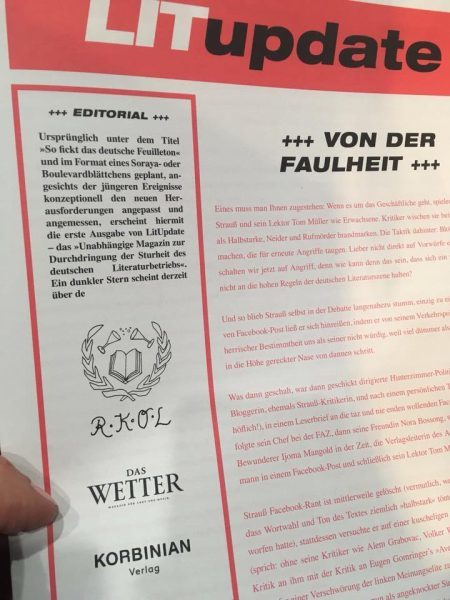Zur Debatte um die Gestaltung der Südfassade einer Berliner Hochschule
Zum Jahreswechsel 1918/1919 versank Berlin in Gewalt. Es war nicht die der Revolution, nicht die der Kieler Matrosen im November, sondern die, die der Angst folgte, dem Gerücht: Dass die anderen doch stark sind. Nachdem der erste Weltkrieg mit Fronten weit vor den Grenzen zu Ende ging, war es die Angst vor kaisertreuer Konterrevolution einerseits und, mehr noch, dem von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg propagierten Bolschewismus andererseits, die den Tod in die Städte holte. Real waren die Rhetoriken der Spartakisten, die zwar gewaltbereit waren, aber nie eine tatsächliche Mehrheit auf den Straßen hinter sich hatten. Real war aber auch die Waffengewalt, die innerhalb von Wochen gewachsene Bereitschaft, mit militärischen Mitteln den Phantom- oder allenfalls Zwergenaufstand niederzuschlagen. Ebert, Scheidemann und Noske, die sozialdemokratischen Regierenden dieser gerade entstehen Republik, ließen den demokratischen Konsens wegen Gerüchten fallen, und nicht nur die konservative, sondern auch die liberale und Teile der linken Presse unterstützten ihre Politik der Gewalt und der Abrechnung. Hunderte Tote in einem vergessenen Bürgerkrieg, aus dem mit den rechten Freikorps, die der linken Regierung die Drecksarbeit abnahmen, die Kernzelle dessen hervorging, was später der deutsche Faschismus werden sollte. In Deutschland, kann man aus der Geschichte lernen, die in diesem ihrem Jubiläumsjahr zum ersten Mal seit langem wieder erinnert wird, geht die Gewalt nie von den Extremen aus. In Deutschland ist nichts so gefährlich wie die Mitte.
Dort ist diese Lehre der Geschichte selbstverständlich nie angekommen. Ein „erschreckender Akt der Kulturbarbarei“ sei die Neugestaltung einer Hausfassade durch die, die das Haus nutzen, sagte die Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU) Ende Januar 2018 knapp am PEGIDA-Sprech vorbei. „Kunst und Kultur brauchen Freiheit, sie brauchen den Diskurs, das ist eine der wichtigsten Lehren aus der Geschichte“, sagte Grütters, „wer dieses Grundrecht durch vermeintliche political correctness unterhöhlt, betreibt ein gefährliches Spiel.“ Here, also, we go again.
Mit besserer Laune könnte man sagen: Endlich streiten sich mal wieder Leute um Avantgarde-Poesie! Aber ich habe keine gute Laune, und man streitet sich auch nicht um Avantgarde-Poesie, sondern, wenn überhaupt, um das, was man mal in den 1950ern als Avantgarde verstanden hat, also, was man in den 1950ern dachte, was ein Weg in die Zukunft sein könnte, als man das auch noch von Atomkraft dachte, von Marktwirtschaft und Free Jazz - von Sachen also, die heute primär noch grauhaarige Männer verteidigen. Man würde, wenn überhaupt, um Poesie streiten, die von Anfang an auf das Deutschlehrbuch abzielte, die poetische Entsprechung von Konformsurrealisten und Mehrheitsaneckern wie Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt, aber selbst das wären ja noch gute Kämpfe. Nein, man streitet vielmehr um die Wandgestaltung eines Nutzbaus in einem sogenannten sozialen Brennpunkt, den vermutlich die wenigsten, die nun am Streit partizipieren, je betreten haben.
Um kurz zu rekapitulieren: 2011 gewann der Pionier der Konkreten Poesie, Eugen Gomringer, den Alice Salomon Poetik Preis, der unter anderem von der Alice-Salomon-Hochschule vergeben wird. Im Anschluss und zu seiner Ehrung entschied die Verwaltung der Hochschule, besagtes Gedicht in der Höhe von vier Obergeschossen an die Fassade des Schulgebäudes zu schreiben. Kritik an dieser nicht hochschulöffentlich diskutierten Entscheidung gab es schnell in der politisch stets sich als links verstehenden Studierendenschaft. Ob aus der Perspektive heraus betrachtet, dass da das eigene Haus ungefragt angemalt wird, oder aus der, dass es für die in großer Mehrzahl weiblichen Studierenden der Hochschule nicht angemessen schien, den in das Gedicht leicht hineinlesbaren male gaze, dem man in der langen U-Bahnfahrt nach Hellersdorf eh lange genug ausgesetzt war, jetzt zwanzig Meter hoch noch einmal zu vorbildlicher Poesie erhoben zu sehen, sobald man den vermeintlichen safe space in der rechten Hegemonie der Großsiedlung erreichte – so richtig happy war jahrelang niemand mit dem Gedicht. 2016 wurde dieser Unmut konkreter. Im Frühjahr und Sommer 2017 stimmte schließlich die Hochschulgemeinschaft darüber ab, ob die Fassade neu gestaltet werden sollte. Ein gutes Drittel der Studierenden folgte dem Aufruf, der Senat bestätigte Ende Januar 2018 das demokratische Ergebnis und entschied sich für den salomonischen Vorschlag, Gomringers Werk zu übermalen und von nun an regelmäßig neue Gedichte der Poesie-Preisträger*innen an die Fassade anzubringen. So weit, so Verwaltungsakt, so Hochschulautonomie, so Provinz.
Nun wäre Deutschland aber nicht Deutschland, wenn. Und so kames dann auch. Mit Ausnahme kluger (und das heißt hier auch: schlicht unaufgeregter) Texte von Stefanie Lohaus in der Zeit und Heide Oestreich in der taz fiel das Feuilleton geschlossen über die Hochschule her. Mal war es ein altkluger Hinweis auf die Offenheit jeder Interpretation, die keineswegs nur eine sexistische Lesart des Gedichts erlaubte, mal machte man sich einfach nur lustig über die Snowflakes und PC-Depp*innen, mal war es die große Keule Kunstfreiheit. In einem hochriskanten Akt der Verteidigung der bürgerlichen Freiheiten spielte das Axel-Springer-Verlagshaus die „avenidas“ über die Leuchtbänder auf dem Dach ab , die Akademie der Künste am Pariser Platz gestaltete seine Glasfassade mit einem anderen Gomringer-Gedicht: „schweigen“. Und in Gomringers Wohnort Rehau wurde der Faschismus durch die Neugestaltung der Fassade des städtischen Museums zurückgeschlagen, wo die „avenidas“ nun Fränk*innen sexistisch erscheinen dürfen, wann immer es ihnen passt, solang sie nicht aufmucken. Es war also alles wie immer, und das ist auch okay, ein Deutschland, in dem die Welt sich nicht dümmer gibt, als sie ist und die FAZ durchdreht, wo sie Feminismus ahnt, wäre ja auch nicht weiter lebenswert für Kulturkartoffeln wie mich.
Anders ist das bei Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Berlins Kultursenator Klaus Lederer war ja fast ebenso salomonisch wie die ASH selbst, als er sein Bedauern über das Verschwinden des Gomringer-Gedichts ausdrückte, aber betonte, er achte freilich die Hochschulautonomie. Grütters hingegen entdeckte in Hellersdorf nicht weniger als den Nazi-IS am Werk. Grütters, die da von „Kulturbarbarei“ spricht, verteilt einen Haushalt von rund 1,63 Milliarden Euro, den nicht mal seine Nutznießer*innen ernst nehmen. „Für Pläne, die Alte Münze am Molkenmarkt gleich um die Ecke vom Roten Rathaus, in ein House of Jazz zu verwandeln, werden 12,5 Millionen bereitgestellt, die allerdings noch unter dem Vorbehalt eines stimmigen Konzeptes stehen“, schrieb etwa der Tagesspiegel nach der Verteilung von Sondermitteln für Berliner Kultur im Herbst 2016 zum geplanten Großprojekt des Trompeters Till Brönner. 12,5 Millionen Euro zu reservieren, ohne einen vernünftigen Antrag zu schreiben – unkomplizierte Kulturförderung sehr exakt an der Barbarei vorbei! Der Intendant einer weiteren Berliner Kulturinstitution brüstete sich hingegen vor der Verteilung jener Gelder damit, sich einen entsprechenden Antrag am Vorabend der Deadline bei einer Flasche Wein ausgedacht zu haben, Ergebnis der Heißluftproduktion: Aufstockung des Etats in Millionenhöhe. Klar, das ist nicht die persönliche Schuld Grütters. Aber auffällig ist doch: Während Semester für Semester top-ausgebildete Musiker*innen und Künstler*innen straight to Kneipenjob wandern, die Verlagsszene der BRD nach dem VG-Wort-Urteil ums Überleben kämpft (gerade die nun allseits geliebte Lyrik ist beinahe bereits völlig vom Ökonomischen abgekoppelt), die kommunale Kulturförderung in ihren Seilschaften fast schon erstickt ist, experimentelle, laute, andere, auch nicht-deutsche Kultur zwar nicht bewusst umgebracht, aber gerade nun auch nicht gefördert wird, ist es also nun die Entscheidung einer Hochschule für Soziale Arbeit, nach sieben Jahren sei Zeit für einen Neuanstrich, die in Augen der die Vielfalt und Blüte der Kultur dieses Landes beaufsichtigten Politikerin dafür verantwortlich ist, dass die Kunstfreiheit in Gefahr gerät.
Überhaupt: Freiheit der Kunst, Freiheit der Rede, Zensur. Vergisst man ständig, aber: Im Grundgesetz ist der Begriff recht deutlich dort angewandt auf staatliche Stellen. Das SpOn-Forum löscht menschenfeindliche Rede? Die Märkische Oderzeitung druckt deinen Brief schon wieder nicht ab? Der Wirt schmeißt deinen Stammtisch raus? Ärgerlich, aber keine Zensur. Das versucht der Diskurs der Rechten seit Jahren zu ändern, durchzusetzen, dass Meinungsäußerungsfreiheit immer heißen muss, dass alle immer alles sagen dürfen. Wenn staatliche Stellen und Akteure wie das Feuilleton diese Grenzen verwischen und den Zensur-Begriff so weit fassen, dass es gleichbedeutend ist, ein Buch zu verbrennen oder nicht zu wollen, dass sein Inhalt jedem Menschen ins Gesicht gepresst wird, der sich aus der Innenstadt rauswagt, spielen sie ein Spiel, das letztendlich nur Menschenfeind*innen nützt. Die Ausrede, es müssen alle gleichermaßen im Diskurs Gehör finden, ist prinzipiell schön und meinetwegen links, aber die Art, wie es von rechts in die Mitte hinein eingefordert wird, ist gewaltsam. Die Frankfurter Buchmesse etwa – bzw. der Börsenverein, der als eingetragener Verein als Ausrichter fungiert – ist durch kein Gesetz der Welt verpflichtet, rechten Verlagen Standflächen zu vermieten. Sich die Vertragspartner*innen selbst auszusuchen, ist sicher unsympathischer als „Es findet keinerlei Zensur statt“ in die Geschäftsklauseln zu schreiben, Geschäfte mit Rechten zu machen, hinterher mit bunten Luftballons dagegen zu demonstrieren und die Drecksarbeit linken Aktivist*innen auf geschickt platzierten Ständen in der Umgebung zu überlassen, während man selbst die Krone der bürgerlichen Freiheiten trägt, aber einem Prozess könnte der Börsenverein hier mit Ruhe entgegensehen.
Es ist und bleibt ein Unterschied, ob ich verbiete, dass einer „Ausländer raus!“ schreit, oder ob ich sage: „Es ist grundgesetzlich gedeckt, dass er das schreit, aber er soll das halt nicht in meinem Wohnzimmer machen“. Nichts anderes ist in Hellersdorf passiert. Es ist keine radikale Position, sondern eine arg liberale. Niemand verbietet Gomringers Gedicht, seine Bücher bleiben in der Bibliothek. Man will ihn nur nicht als Hausmaskottchen.
Das sind keine juristischen Kleinteiligkeiten. Bei der Frage, wer Redefreiheit einschränkt, geht es stets um die Frage, wer überhaupt die Macht hat, das zu tun. Im Jammern, die eigene Meinung sei unterrepräsentiert, steckt gerade nicht der Wunsch nach einem Marktplatz der Meinungen (wo die eigene vielleicht einfach keine Chance hat), sondern der nach Herrschaft. Wenn rechte Stammtische finden, sie würden von rot-grün-versifften Gutmenschen unterdrückt, ist das zwar dumm, aber nachvollziehbar. Wenn eine de-facto-Bundesministerin aber einer kleinen Hochschulgemeinde, in der sich, wie es außerhalb der studentischen Gemeinschaft ja überhaupt in diesem Land selten der Fall ist, einmal eine gemäßigt feministische Ansicht demokratisch durchgesetzt hat, vorwirft, sie würde damit in der Tradition der hitlerischen Gleichschaltung stehen, eine Macht also zuspricht, die in den allerallerallermeisten Fällen einzig und allein vom Staat ausgeht, und eben gerade auch von denen auf deutschem Boden, dessen Repräsentantin sie ist, legt das zumindest das Fundament für eine verschwörungstheoretisch inspirierte Volksverhetzung.
Und natürlich muss auch der Journalismus zwar ethisch, aber nicht rechtlich betrachtet nicht beiden Seiten Gehör schenken. Dass dennoch quer durch alle Medien beinahe ganz ausschließlich die Position derer, die ohnehin gesellschaftliche Macht haben, unterstützt wurde, und dass kaum ein Interview mit Vertreter*innen der Hochschulgemeinschaft, des Akademischen Senats geführt, kaum aus Pressemeldungen der Betreffenden zitiert wurde, während das alarmistische Geschrei der Elite zur alleinig denkbaren Position gerann, ist ein eklatantes Versagen, das allenfalls dadurch gekrönt wird, wenn den Hellersdorfer Studierenden vorgeworfen wird, mit ihrem Wunsch, nicht tagtäglich von ihrem Haus herab an die gesellschaftliche Realität ihrer Objekthaftigkeit als Frauen erinnert zu werden, den Kampf gegen Sexismus mangels Vermittelbarkeit ihrer Entscheidung an den Stammtischen zu unterwandern. Die Presse hätte sich nicht solidarisieren müssen, auch wenn das keine große Tat gewesen wäre angesichts des kleinen Themas, aber sie hätte zumindest ausgewogen berichten und versuchen können, auch die Position derer, die das Gedicht ersetzen wollten, nachvollziehbar zu machen. Und Monika Grütters hätte ihren Charlottenburger Wähler*innen Hochschulautonomie und die tatsächliche Bedeutung von Kunstfreiheit erklären können, das Temperament der Diskussion loben, die Bedeutung der Poesie als Folie gesellschaftlicher Realität betonen, statt aber auch noch jedes rechte Ressentiment zu bedienen, das sich zwischen Alice-Salomon-Platz und Konrad-Adenauer-Haus finden ließ.
Und hier schließt sich der Kreis zur deutschen Geschichte. In einer Situation, in der die deutsche Linke parlamentarisch nunmehr nur noch nominell existiert, sich in massenunwirksamer wie notwendiger Identitätspolitik verwirklicht statt real nach der Macht zu greifen, während die Straße, zumindest abseits der Städte und längst auch in Berlin mehr und mehr der Rechten gehört, weiter eine Gefahr von links zu beschwören, mag machtpolitisch nachvollziehbar sein. Das ändert nichts an der Fahrlässigkeit. Statt die Bedrohungen der Freiheit der Diskurse dort zu benennen, wo sie real sind, immer wieder auf eine Minderheit einzudreschen, die ohnehin – als Frauen, als Feminist*innen, als Studierende der Sozialen Arbeit – in den Strukturen dieser Gesellschaft fern der Macht stehen, halten Grütters und das Feuilleton Feuer an eine Lunte, die der Rechtspopulismus gelegt hat. Grütters wird die mögliche Gewalt, die aus ihrer Herabwürdigung der Studierendenschaft zu Barbar*innen und Zensor*innen hervorgehen könnte, sicher nicht legitimieren, aber sie spielt einen Diskurs mit, der über kurz oder lang zwangsläufig dazu führen wird.
„Neues Blutvergießen soll angerichtet werden. Es ist uns schwer geworden, unser Einverständnis dazu zu erklären, dass auf Frauen und Kinder, auf Mütter und Väter geschossen werden soll. Aber die Spartakusbande will es nicht anders und nun müssen wir handeln“, sprach der SPDler und Mitglied des Reichsrätekongresses Robert Leinert Anfang 1919 auf einer Demo unmittelbar vor der brutalen Niederschlagung des Spartakusaufstands und der durch Gustav Noske unterstützten Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs. Es war ein Gerücht von der Macht der Anderen, dass die Hemmungen fallen ließ. Ein weiter Bogen, von 1918 zu 2018, von Noske zu Grütters, von Spartakus zur ASH? Hoffentlich.