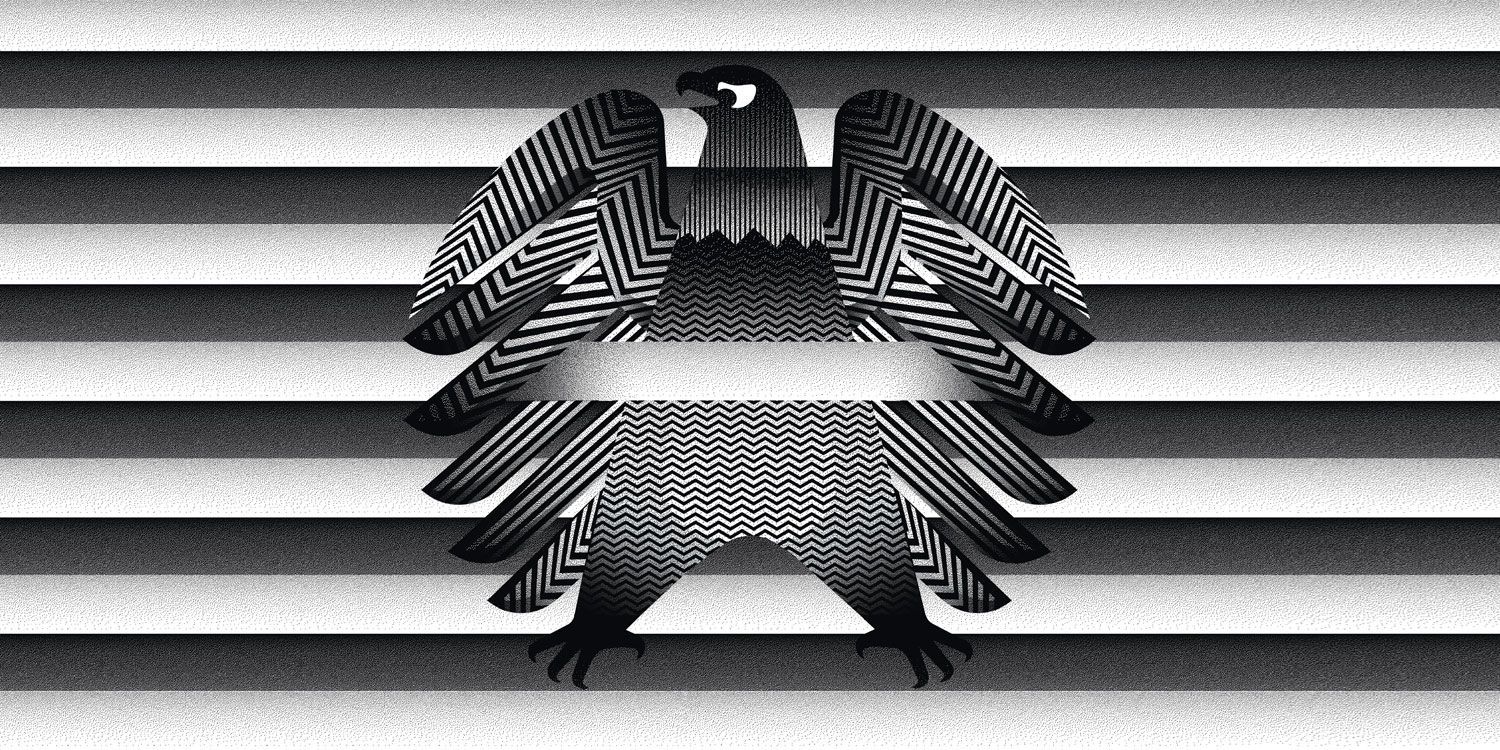Parteien und Wähler sind in Zeiten zunehmender Vernetztheit besorgt über mögliche Hackerangriffe während der Bundestagswahl. Zu Recht, wie sich nun herausgestellt hat: Eine Software, mit der Wahlergebnisse übertragen werden, ist angreifbar. WIRED hat sich bereits für seine Sommer-Ausgabe bei den Parteien umgehört und sich einen Überblick über die Sicherheitsvorkehrungen verschafft.
Von Max Biederbeck, Chris Köver, Dirk Peitz
„Guten Tag, ich komme von der CDU und möchte Ihnen ein paar Informationen zur Bundestagswahl dalassen." Peter Tauber steht im April, es sind noch fünf Monate bis zur Bundestagswahl im September, vor einer Tür. Doch die kurzhaarige Frau, die ihm geöffnet hat, sagt ein paar ungemütliche Sekunden lang nichts. Nicht weil sie perplex wäre, dass aus heiterem Himmel der CDU-Generalsekretär vor ihr erschienen ist. Sondern weil das System hängt. Die Frau in der Tür ist eine Videosimulation auf einem Flachbildschirm, und Tür und Monitor sind im zweiten Stock der Parteizentrale Konrad-Adenauer-Haus in Berlin aufgebaut.
Türen sind normalerweise ja dazu da, um hindurchzugehen. Diese aber ist eine Attrappe, aufgestellt zu Übungszwecken für Wahlkampfhelfer. Sie soll ihnen und der CDU dabei helfen, Stimmen für Angela Merkel zu sammeln. Die Partei will analogen Haustürwahlkampf mit digitalen Mitteln vereinen, das Alte mit dem Neuen. Aber dafür muss Letzteres halt erst mal funktionieren.
Das Neue macht andererseits viele nervös. Die zunehmende Digitalisierung der politischen Auseinandersetzungen scheint die Anspannung zu steigern, die in Deutschland seit den Erfolgen der AfD und der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im vergangenen Jahr ohnehin herrscht. Angst scheint umzugehen, die den Deutschen als so typisch zugeschriebene German Angst vorm Ungewissen. Die dazu passenden aktuellen Buzzwords lauten: Big Data, Fake News, Social Bots, Microtargeting, Hacking.
Es ist höchste Zeit, die Luft aus all den Buzzwords zu lassen. Und sich zu fragen: Wie ist die digitale Lage der deutschen Politik wenige Monate vor der Bundestagswahl wirklich? Wie werden die Parteien Wahlkampf führen, im Netz, aber nicht nur dort? Was wollen sie, was dürfen sie, was können sie eigentlich? Und was droht ihnen aus dem Netz - etwa E-Mail-Leaks, wie sie der Clinton- und der Macron-Kampagne widerfahren sind, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen allerdings? Was sind die Lehren, die man aus dem Sieg Trumps und der Niederlage Clintons ziehen kann - und welche Dinge sind auf Deutschland überhaupt übertragbar? Was wird mutmaßlich passieren bis zum 24. September, und was lässt sich einfach nicht voraussagen?
WIRED hat deutsche und amerikanische Wahlkämpfer dazu befragt, Digitalstrategen, Politikberater. Wir haben sie um eine nüchterne Einschätzung der gegenwärtigen Situation gebeten. Denn Angst ist kein guter Berater, schon gar nicht in der Politik.
I. Big Data
Im zweiten Stock des Konrad-Adenauer-Hauses wähnt man sich in der Kulisse eines Berliner Startups: viel Licht, skandinavisches Design, aus versteckten Lautsprechern dringt leise House Music. Nur die Leute passen nicht recht ins Bild, die meisten tragen Anzug und haben den Scheitel etwas zu akkurat gezogen für Startup-Mitarbeiter. Connect 17 heißt das Haustürwahlkampfprojekt, dahinter steckt logistisch vor allem die Junge Union, deren 33-jähriger Bundesgeschäftsführer Conrad Clemens das Team anführt. Ihm und seinen zehn Mitarbeitern hat Tauber Platz freigeräumt auf der Wahlkampfetage, in Rufreichweite zu den Tischen, an denen die Leute der für die CDU arbeitenden Werbeagentur Jung von Matt sitzen und die von Merkels Kampagnenmannschaft.
Glaubt man Tauber, so wird Connect 17 für die Wahl noch entscheidend werden. Ein erster Testlauf war anscheinend bereits erfolgreich, im Saarland haben CDU-Unterstützer im Vorfeld der Landtagswahl im März an 75 000 echten Türen Gespräche mit Wählern geführt, ihre Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer hat jedenfalls hoch gewonnen. Bei Leuten zu klingeln, das ist eine sehr alte Methode, neu aber ist, dass nun digitale Werkzeuge eingesetzt werden, um die Methode effizienter zu machen: Eine Smartphone-App teilt den Helfern mit, wo potenzielle CDU-Wähler wohnen. Datengetriebene Wählerpotenzialanalyse nennt man das.
Am 24. September werden laut des Statistischen Bundesamtes 61,5 Millionen Deutsche wahlberechtigt sein, 31,7 Millionen Frauen und 29,8 Millionen Männer. Das sind viel zu viele Türen zum Anklopfen, und nicht hinter allen wohnen potenzielle CDU-Sympathisanten. Sie muss man finden. Und dabei kann Big Data helfen.
Die Datenbank der CDU, auf der Connect 17 basiert, benutzt ein ähnliches System, das auch SPD, Grüne oder die Linke verwenden: eine große Deutschlandkarte, auf der man in die Wahlbezirke reinzoomen kann; ein solcher soll gemäß der Bundeswahlordnung in Deutschland höchstens 2500 Einwohner umfassen. Für jeden einzelnen lassen sich frühere Wahlergebnisse und die jeweilige Beteiligung bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen aus den öffentlich zugänglichen Zahlen der Bundes- und Landeswahlleiter übereinanderlegen.
Diese kann man mit weiteren Daten kombinieren, die man beim Geomarketing-Unternehmen Microm einkaufen kann, sogenannten Soziostrukturdaten zu Alter, Geschlecht, Konfession und Einkommen in einem Wahlbezirk. So weiß man als Partei bis auf die einzelnen Baublöcke einer Stadt heruntergebrochen mit relativ hoher Sicherheit, wo es sich lohnt, aktiv zu werden. Das ist ein grobes Raster, aber es ist eines.
In den USA bildet die Mobilisierung an der Haustür schon lange das Fundament eines jeden Wahlkampfs. Doch die Kampagnenmacher der Republikaner und Demokraten sind nicht den strengen deutschen Datenschutzregeln unterworfen, sie wissen erheblich mehr über Wähler als ihre Counterparts in den Berliner Parteizentralen.
„In den USA kauft man den Datensatz und baut eine eigene Datenbank damit auf", sagt Julius van de Laar. „Jede Kampagne hat im Endeffekt 250 Millionen Wählerdaten mit allem, was man sich vorstellen kann." Das heißt Name, Anschrift, Telefonnummer, Alter, Bildungsgrad, Einkommen, ethnische Zugehörigkeit, aber auch Daten aus sozialen Medien - bei welchen Fan-Pages etwa der Betroffene ein Like gesetzt hat. Dazu kommen Informationen über das Konsumverhalten: Welches Auto fährt die Person, welche Zeitungen hat sie abonniert? Ein Teil dieser Informationen ist in den US-Wählerregistern frei zugänglich, etwa ob sich jemand als Demokrat oder Republikaner registriert hat und wie oft sie oder er zuletzt wählen war. Der Rest an persönlichen Informationen wird zugekauft oder selbst erhoben.
Van de Laar ist 34, war aber bereits 2008 und 2012 im Team von Barack Obama. Der ließ den ersten total datenbasierten Wahlkampf überhaupt führen, der Deutsche van de Laar war im Bundesstaat Ohio für die Wählermobilisierung zuständig. Heute sitzt er in einem Altbaubüro in einem Hinterhof in Berlin-Mitte und berät Parteien und Unternehmen in Deutschland in Kampagnenfragen. Der Heilige Gral für Wahlkämpfer, sagt van de Laar, sei ein Datenmodell, das nicht nur viel wisse über die Wähler, sondern stetig klüger werde. Weil es nicht nur Daten ausspuckt, sondern permanent mit neuen gefüttert wird und so immer genauere Vorhersagen trifft.
Theoretisch könnte die Connect-17-App der CDU das ansatzweise leisten, jeder Wahlkampfhelfer soll nach einem Gespräch an einer Tür in die App eingeben, ob ein Mann oder eine Frau geöffnet hat, wie alt die Person schätzungsweise war und ob sie der Union gegenüber wohlwollend, neutral oder ablehnend eingestellt war.
Im Obama-Wahlkampf sei die Verfeinerung fast in Echtzeit passiert, so van de Laar: Abends wurden 10.000 Anrufe in eine bestimmte Zielgruppe gemacht, über Nacht wurden die Ergebnisse ins Modell aufgenommen und neu berechnet. Wer am nächsten Morgen die App öffnete, um wieder in den Häuserwahlkampf zu ziehen - die laut van de Laar preiswerteste und effizienteste Art der Wählermobilisierung -, sah bereits andere Namen angezeigt als am Tag zuvor. Etwa weil man festgestellt hatte: Schwarze Frauen unter 40 wählen uns in Ohio sowieso, um die müssen wir uns nicht mehr kümmern.
Doch genau der Glaube an solche Analysen könnte nun Hillary Clinton, für deren Team die beiden Obama-Wahlkämpfe 2008 und 2012 das erklärte Vorbild waren, zum Verhängnis geworden sein. Das schreiben zumindest Jonathan Allen und Amie Parnes, die Autoren des im April in den USA erschienenen Buchs , das für jeden deutschen Wahlkämpfer eine Blaupause liefert, wie ein sicher geglaubter Sieg in einer verheerenden Niederlage enden kann. Parnes und Allen haben die Clinton-Kampagne über Monate des Wahlkampfs hinweg begleitet und nahezu ungehinderten Zugang zum Inneren der scheinbar so gut geölten Clinton-Wahlkampfmaschine bekommen. Was sie vorfanden, hatte mit deren öffentlichem Bild fast nichts zu tun. Neben allerlei Intrigenkolportage diskutiert das Buch eine entscheidende Frage: Hat Clintons leitender Wahlkampfmanager Robby Mook womöglich zu sehr an Daten geglaubt bei seinen Entscheidungen - und hatte aber entweder die falschen oder hat sie falsch interpretiert? Könnte das deutschen Wahlkämpfern als Warnung dienen?
Ada, so der Name des vermeintlich unschlagbaren Algorithmus der Clinton-Kampagne, rechnete laut eines Berichts der Washington Post bis zu 400.000 mögliche Wahlausgänge pro Tag aus. Ada wurde laufend mit neuen Umfragen und Feedback der Wahlhelfer aus den 50 Bundesstaaten gefüttert, die je nach Bevölkerungsgröße unterschiedlich viele Wahlleute ins electoral college entsenden, das den Präsidenten wählt. Ada sah fälschlicherweise Michigan und Wisconsin als sicher an für Clinton. Es waren am Ende rund 80.000 Stimmen Vorsprung in den beiden Bundesstaaten und in Pennsylvania, die Trump die Mehrheit im electoral college brachten.
Letzteres ist nun eine spezifische Gegebenheit des amerikanischen Wahlsystems, die im deutschen keine Entsprechung hat. In welchem Bundesland die Parteien bei der Bundestagswahl ihre Zweitstimmen gewinnen, die über die Sitzverteilung im Bundestag entscheiden, ist im Prinzip egal. Dass auf Clinton insgesamt fast drei Millionen mehr Wählerstimmen entfielen, wird ihr ewiger Trostpreis bleiben - in Deutschland würde die Partei, auf welche die meisten Stimmen entfallen, erst mal mit der Regierungsbildung beauftragt. Aber auch eine deutsche Koalition braucht jede Wählerstimme.
II. Microtargeting, Fake News, Bots
Ein Märzabend in Berlin, noch ist das für Robby Mook verheerende Buch Shattered nicht erschienen, als er in einem überlaufenen Konferenzraum der Stiftung Neue Verantwortung von seinen Erfahrungen in der Clinton-Kampagne berichtet. Die Fragen, die ihm gestellt werden, drehen sich um den Datengebrauch im Wahlkampf, Fake News, die Rolle von Social Media. Mook spricht lange über die Art, wie sein Team Technologie vor allem dazu genutzt habe, freiwillige Helfer zu finden.
„Technologie sollte diesen Prozess effizienter gestalten und uns mehr Zeit geben für das eigentlich Entscheidende, die menschliche Interaktion zwischen Wahlhelfern und Wählern. Freiwillige sind die überzeugendsten Botschafter, um eine zutiefst menschliche Geschichte zu erzählen: Warum es wichtig ist, dass der Einzelne wählen geht und unsere Kandidatin unterstützt. Soziale Medien gewinnen an Bedeutung, doch wirklich wichtig an ihnen ist, dass Menschen dort etwas mit anderen teilen: Sie öffnen anderen die Tür zu Informationen." Auf Social Media zähle, dass eine Kandidatin, ein Kandidat eine authentische Stimme entwickle.
So blumig also lässt sich umschreiben, was Donald Trump auf Twitter gelungen ist - und Hillary Clinton so richtig weder auf sozialen Medien noch sonst wo. Aber das sagt Mook an diesem Abend in Berlin nicht. Sondern nur noch, dass Falschmeldungen und deren Weiterverbreitung durch Fake-Profile ein Problem gewesen seien, dem er mehr Aufmerksamkeit hätte schenken sollen. Den entscheidenden Grund für die Niederlage im November kann oder will Mook auch Monate später nicht identifizieren. Mutmaßlich gibt es auch nicht nur einen. Für Mook wäre die angenehmste Erklärung zugleich diejenige, die jetzt deutsche Wahlkämpfer beunruhigen könnte: nicht eigene Fehler, sondern unheimliche Mittel des Gegners haben den Wahlausgang bestimmt.
Ein Text, der Anfang Dezember im Magazin des Schweizer Tages-Anzeiger erschien und sich in Deutschland rasch über Facebook verbreitete, erzählte die Geschichte so: Donald Trump hatte womöglich eine sozialmediale Geheimwaffe zur Verfügung, die nichts mit dessen Twitter-Feuerwerken zu tun hatte. Die britische Firma Cambridge Analytica habe im Auftrag Trumps im ganz großen Maßstab eben genau Facebook durchwühlt, die Nutzer nach dem sogenannten Ocean-Modell psychometrisch vermessen, in einzelne Gruppen mit spezifischen biografischen Daten und Interessen zerlegt und diese Gruppen anschließend mit je maßgeschneiderten Botschaften per Microtargeting gleichsam sozialmedial an die Wahlurnen getrieben, um für Trump zu stimmen.
Julius van de Laar war im Januar in den USA, hat dort mit republikanischen Digitalwahlkämpfern gesprochen und auf seine Fragen nach Cambridge Analytica die Antwort bekommen: „Wir wissen gar nicht, wer die sind." Cambridge Analytica habe laut eigener Aussage den Trump-Leuten angeboten, Psychometrie einzusetzen, aber nie ein Go bekommen, so van de Laar. Der Schweizer Magazintext habe beschrieben, „was vielleicht in der Theorie möglich sein könnte, aber es kam faktisch nicht zum Einsatz. Das war gigantische PR für Cambridge Analytica, und viele hier sind ihr auf den Leim gegangen."
Einer, der Trumps Wahlkampf noch näher beobachtet hat, war Teddy Goff, er war Clintons Chief Digital Strategist und als solcher zwangsläufig auch mit der Konkurrenz beschäftigt. Er sagt: „Die Methoden von Cambridge Analytica wurden auch in den USA weidlich diskutiert. Mittlerweile besteht ziemliche große Einigkeit darüber: Diese Firma ist completely full of shit. Es gibt nicht mal Belege dafür, dass sie das Facebook-Targeting wirklich hinbekommen hat, wie sie das behauptet hat. Und selbst wenn sie das geschafft hätte, besteht doch große Skepsis darüber, wie effektiv dieses Mittel sein kann."
Goff ist wie van de Laar einer der noch jungen Obama-Kampagnenveteranen, er ist kaum 30, war im Jahr 2012 aber bereits Obamas Digitalchef. Er hat damals mit 200 Mitarbeitern eine bis heute als maßgeblich geltende Netzstrategie entworfen: Social Media erobern, riesige E-Mail-Newsletter-Verzeichnisse aufbauen, Onlinewerbung schalten. Für Letztere allein hat er damals 100 Millionen Dollar ausgegeben - was angesichts der Gesamtsumme von knapp 1,3 Milliarde Dollar, die der zweite Präsidentschaftswahlkampf von Obama gekostet hat, allerdings nicht die Welt war. (Zum Vergleich: In Deutschland haben im bisher letzten Bundestagswahljahr 2013 alle Parteien zusammen lediglich 151,4 Millionen Euro für Wahlkampfmaßnahmen jeglicher Art ausgegeben.)
Goff sagt über Deutschland: „Wäre ich Angela Merkel oder Martin Schulz, würde ich mir keine Sorgen darüber machen, dass es irgendwo eine magic bullet geben könnte, dank derer Firmen wie Cambridge Analytica im September unerhörte Massen an die Urnen bringen könnten, die etwa für die AfD stimmen. Mir würde Sorgen machen, dass ein Set von nationalistischen, ausländerfeindlichen Ansichten, die vor 20 Jahren noch tabu gewesen wären in Deutschland, nun anscheinend geäußert werden können und womöglich eine Dynamik entwickeln - auf Plattformen, die von niemandem geführt, redigiert oder moderiert werden. Solche Eigendynamiken sind ein Grundkennzeichen netzbasierter Kommunikation, und in politischer Hinsicht können sie einem durchaus Angst bereiten."
Das ominöse Microtargeting auf Facebook ist auch laut den aktuellen deutschen Kampagnenmanagern total überschätzt. „Es gibt im Moment keinen Beweis, dass sich das überhaupt lohnt", sagt etwa Stefan Hennewig, Kampagnenchef der CDU. Wer 50 verschiedene Teilzielgruppen ansprechen wolle, müsse diese erst mal definieren, dann zu jedem Thema 50 verschiedene Botschaften produzieren - ein irrer zeitlicher und finanzieller Aufwand. Je feiner die Zielgruppe, umso teurer würde außerdem das Schalten von Facebook-Anzeigen. „Wenn die Kosten ungefähr fünf Mal so hoch sind wie bei einer Streusendung", sagt Hennewig, „müsste der Effekt ja auch fünf Mal so hoch sein, damit es sich lohnt. Mich überzeugt das nicht." Die politische Haltung der CDU - „Maß und Mitte" - gelte auch für die Nutzung von Daten im Wahlkampf: „Wir gehen nicht in die Extreme."
Für die FDP bestätigt deren Bundesgeschäftsführer Marco Buschmann, dass psychologische Wähleranalysen im Wahlkampf keine Rolle spielen werden. Es gibt in Deutschland auch tatsächlich kaum eindeutig legale Möglichkeiten, etwa Facebook-Profildaten zu benutzen, ohne gegen den Zweckbindungsgrundsatz bei der Datenverwendung zu verstoßen. Und doch fürchten sich offenbar viele vor einem solchen Szenario.
Matthias Riegel, der als Chef des Agentur-Verbunds Ziemlich beste Antworten den Wahlkampf der Grünen betreut, sagt dazu: „Wir müssen einen Umgang mit dieser Angst finden." Die Partei sieht sich umgekehrt sozialmedialen Angriffen ausgesetzt: „Die Grünen wirken ja auf Hetzer und Trolle wie ein Magnet - wir gehen davon aus, dass sie zur Zielscheibe von Hass, Lügen und viel Dreck werden. Umso deutlicher werden wir auch in den sozialen Medien machen, wofür die Grünen stehen: Weltoffenheit und Toleranz."
Wie hoch der Anteil des Wahlkampfbudgets ist, der für Social Media veranschlagt wird, darüber geben die meisten deutschen Parteien keine Auskunft. Lediglich Robert Heinrich, Wahlkampfmanager der Grünen, beziffert ihn genau: 50 Prozent des Budgets wandern ins Netz. Vor allem in der heißen letzten Phase vor der Wahl wollen die Grünen damit Öffentlichkeit für ihre Botschaften schaffen und emotionale Geschichten auf Facebook, Youtube oder Instagram erzählen.
Doch was genau haben die Parteien bislang im Wahljahr 2017 auf Facebook so getrieben, dem mit rund 28 Millionen Mitgliedern in Deutschland wichtigstem sozialen Medium? Das hat WIRED zusammen mit der Digitalmarketingplattform Online Marketing Rockstars und dem Social-Media-Analytics-Anbieter quintly untersucht.
Die mit Abstand meisten Facebook-Fans hat danach die AfD mit aktuell 321.000 Followern, gefolgt von der Linken mit 186.000 und der CSU mit 166.000. Bei der sozialmedialen Gefolgschaft führen also Parteien, deren Positionen und Personal polarisieren. Oder, so ein längst geläufiger Verdacht zumindest gegenüber der AfD, den eine Recherche der FAZ im Februar bestätigen konnte: Die Follower- und Interaktionszahlen könnten aufgebläht sein durch Bot-gesteuerte Fake-Profile, was aber auf Facebook erheblich schwieriger nachvollziehbar ist als auf Twitter.
Die AfD führt jedenfalls bei allen wesentlichen Facebook-Kennziffern mit großem Abstand vor allen anderen Parteien: Sie hat die meisten Likes und andere Reaktionen auf Posts eingestrichen (fast eine Million), die meisten Kommentare (321.000), die meisten Shares (343.000). Doch auch da muss man den Vorbehalt mitbedenken, dass womöglich ein Teil dieser Interaktionen automatisiert geschehen sind, von Bots gesteuert.
„Die AfD ist für mich die erste erfolgreiche Internetpartei", sagt Mathias Richel, der im Jahr 2013 Wahlkampf für die SPD machte und künftig das Berliner Büro von Jung von Matt leitet, dort nach eigenen Angaben aber nichts mit dem CDU-Wahlkampf zu tun haben wird. Keine andere Partei sei wie die AfD so gut darin, ihre Botschaften über Twitter und vor allem Facebook zu verbreiten und Wähler zu mobilisieren, mit tagesaktuellen Share-Pics und GIFs. Ereignisse wie etwa die Straftat eines Geflüchteten werden sofort aufgegriffen und so gedreht, dass sie die Botschaften der Partei unterstreichen.
Während sonst so oft die Personalisierung der deutschen Politik beschrien wird, ist sie sozialmedial erstaunlich schwach: Mit 2,4 Millionen Facebook-Fans hat Angela Merkel zwar die meisten aller deutschen Politiker, doch im Vergleich zu 52,5 Millionen Followern von Obama und 23,3 Millionen von Trump sind das wenige.
Weil alle drei weltweit bekannte Persönlichkeiten sind, besteht ihre jeweilige Facebook-Gefolgschaft nicht nur aus potenziellen Wählern aus dem eigenen Land. Analysiert man ihre Fanpages genau, so stößt man aber auf etwas Erstaunliches: Nur 24 Prozent von Merkels Facebook-Fans leben in Deutschland; von Barack Obamas Fans wohnen immerhin 30,1 Prozent in dessen Heimatland USA, von Donald Trumps Gefolgschaft 52,3 Prozent.
Merkels Fan-Base ist seltsam: Außer in Deutschland hat sie am meisten Facebook-Fans im Irak (rund 213.000) und in Ägypten (rund 94.000); erst danach folgen die USA mit knapp 85.000 Fans. Die CDU hat auf Nachfrage dafür nur die Erklärung parat, die auch auf Merkels Fanpage zu finden ist: Die CDU habe „zu keinem Zeitpunkt den Kauf von Followern beauftragt oder veranlasst", verweist ansonsten auf das hohe Ansehen der Kanzlerin im Ausland und auf die International Page Suggestions von Facebook, die Nutzern vorschlagen, Merkel zu liken.
In jedem Fall ist der Hebel, mit dem die CDU über diese Seite Wahlkampf in Deutschland betreiben könnte, erheblich kleiner, als die Zahl von 2,4 Millionen Fans suggeriert. Die Kanzlerin kann sich aber damit trösten, dass ihr SPD-Konkurrent Schulz bislang nur 312.000 Fanpage-Likes hat, wovon 53,8 Prozent in Deutschland leben.
Die sozialen Medien, so kann man es auch betrachten, sind hierzulande sowieso vergleichsweise unbedeutend, die Mehrheit der Deutschen erreichen sie schlicht nicht. Und diejenigen, die auf Facebook sind, folgen dort nur in geringer Zahl Politikern oder Parteien. Die wiederum wagen auf Social Media einstweilen keine technischen Experimente oder gar Fragwürdiges. Social Bots etwa will keine Partei im Wahlkampf einsetzen, und der einzige parteieigene Chat-Bot auf Twitter, der Programm-Erklärbär @FDPShots der Liberalen, glänzt mit einer wiederkehrenden Antwort: „Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Schreibweise richtig? Anderen Begriff versuchen?" Verdammte neue Technologien.
III. Hacking
Ein beängstigendes Ereignis, das zwar bereits eingetreten ist, aber erst noch eine Wirkung entfalten könnte, ist um den Jahreswechsel 2014/15 geschehen. Damals gelang es Hackern, in das Serversystem des Bundestages einzudringen und rund 16 Gigabyte Daten zu erbeuten. Bis heute, Stand Anfang Mai 2017, ist aber kein Material an die Öffentlichkeit gedrungen. Weil es nichts Aufsehenerregendes enthält? Oder wartet jemand nur auf den richtigen Zeitpunkt? Ein hochrangiger Sicherheitsexperte sagt dazu gegenüber WIRED: „Wenn sich in den Bundestagsdaten wirklich kritisches Material befunden hat, müssten wir eigentlich sehr bald davon hören.“
Klar scheint nur, wer für den Hack verantwortlich war: die Gruppe APT28, die auch unter den Namen Fancy Bear und Sofacy Group agiert, ihre Aufträge offenbar von russischen Geheimdiensten oder direkt aus dem Kreml bekommt. Ihr wird auch der Hack der Clinton-Kampagne zugeschrieben. APT28 soll in diesem Frühjahr einen weiteren, aber erfolglosen Angriff auf deutsche Rechner gestartet haben, auf die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung und die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Absicht scheint klar: Die Gruppe zeigt Präsenz.
Wann immer über Hacks in staatliche oder politisch sensible Computersysteme diskutiert wird, fällt heute der Name APT28. Viel Geld und Personal fließe in die Gruppe, sie nutze „Malware mit Features, die für andauernde Operationen gedacht sind“, heißt es in einem aktuellen Report der Sicherheitsfirma Fireeye. Gerade die jüngsten Angriffe zeigten aber, dass die deutschen Behörden aus zurückliegenden Vorfällen gelernt haben.
Nach 2015 sind sowohl bei Sicherheitsbehörden als auch der Bundeswehr neue Netzwerke entstanden, um sich gegen Eindringlinge zu schützen. Damit geht zwar teils blinder Aktionismus einher – zum Beispiel wenn das Verteidigungsministerium von „Cyber-Gegenschlägen“ und „Hack-Backs“ spricht, ohne zu erklären, wie die aussehen sollen. Auch hapert es nach wie vor an Software und Personal. Aber die Gefahr ist erkannt.
Doch ist die Bundestagswahl als solche zu hacken? Das kann Constanze Kurz beantworten, Sprecherin des Chaos Computer Clubs (CCC). Kurz beschäftigt sich als Wissenschaftlerin und auch für den CCC mit der Manipulation von Wahlen. Sie hat 2009 als Expertin vor dem Bundesverfassungsgericht ausgesagt, als das über den Einsatz von Wahlcomputern in Deutschland verhandelte und ihn schließlich verbat. Die Manipulation solcher Automaten, wie sie in den USA zuletzt befürchtet wurde, sich aber nicht bestätigte, ist hierzulande seither schlicht unmöglich. In Deutschland macht jeder Wähler seine Kreuzchen auf Papier, und das ist nicht zu hacken.
Als konkretes Angriffsziel auf den Wahlvorgang bliebe in Deutschland nur eine Software, mit der die Landeswahlleiter Stimmen zusammenzählen, sagt Kurz. IVU.elect sei eine beliebte. Der CCC untersucht diese derzeit danach, „ob jemand absichtlich von außen in den Prozess eingreifen könnte.“ Bislang hat der CCC keine Sicherheitslücken gefunden, lautet der beruhigende Befund.„Die Frage ist aber gar nicht, ob jemand diesen Prozess wirklich manipulieren könnte“, sagt Kurz. „Es geht darum, ob Zweifel an den Abläufen auftauchen, die das Vertrauen in die Wahl untergraben könnten.“
Das ist am Ende der entscheidende Punkt: Eine Demokratie basiert auf dem Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen und demokratischen Abläufe. Entsteht Misstrauen in den Prozess von Wahlkampf und Wahl selbst, wird das Misstrauen gar absichtlich gesät, entstehen Unsicherheit, Nervosität, Angst.
Die Angst nützt manchen. Sie hilft Parteien vom Rand, die sich mit vermeintlich manipulativen digitalen Fähigkeiten größer und unheimlicher machen können, als sie in Wahrheit sind. Sie hilft aber auch etablierten Parteien, die Tatkraft vorgaukeln können, wo mitunter nur aufgeregte Ratlosigkeit herrscht. Und sie hilft ausländischen Mächten, die ihren strategischen Einfluss mit relativ einfachen Mitteln ausdehnen können. Fake-News-Produktion und Hacking sind billig, und sie treffen als permanente Bedrohung einen empfindlichen Nerv.
Die Angst ist in Deutschland jedoch objektiv in vielerlei Hinsicht nicht gerechtfertigt. Die Gefahren im und aus dem Netz sind zumindest derzeit noch gering. Eigentlich niemand kann, will, darf das tun, wovor wir uns fürchten: uns als Wähler manipulieren. Jedenfalls nicht mehr, als jede seit Jahrzehnten bekannte analoge Methode im Wahlkampf das könnte. Es ist wie so oft im Leben: Angst ist erst mal nur ein Gefühl.